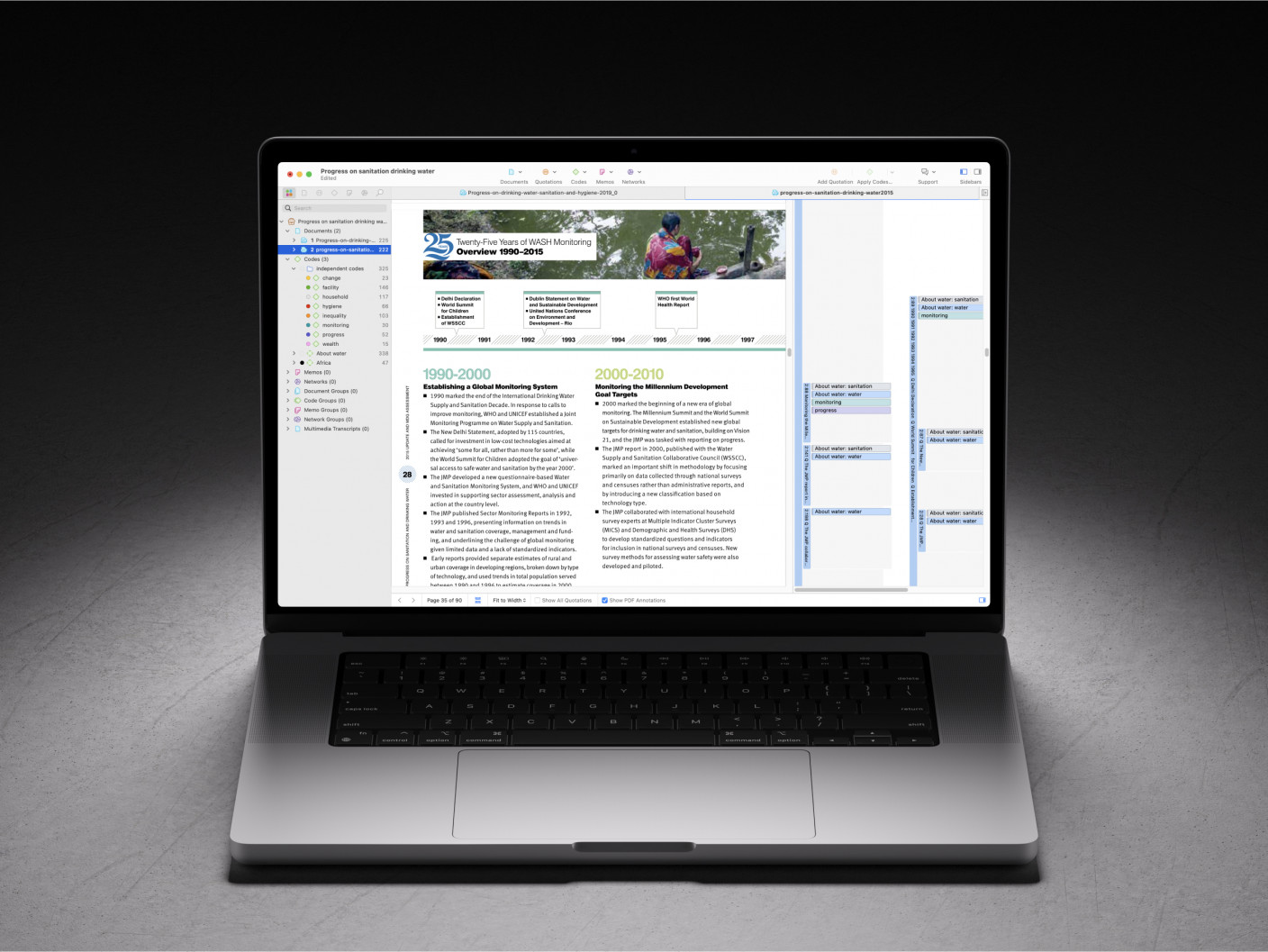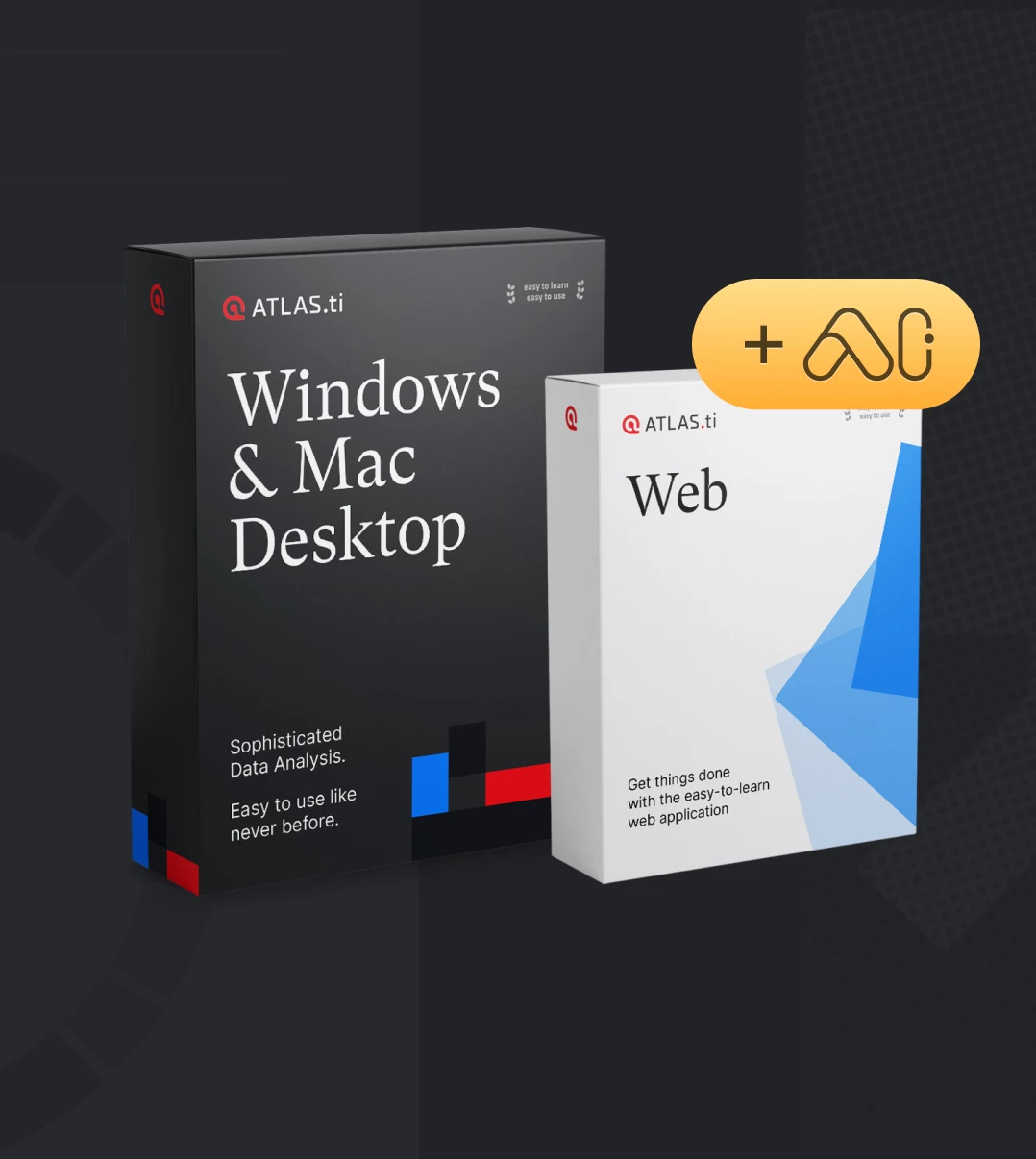Der Leitfaden zur Interviewanalyse
- Was ist eine Interviewanalyse?
- Vorteile von Interviews in der Forschung
- Nachteile von Interviews in der Forschung
- Ethische Überlegungen bei Interviews
- Vorbereitung eines Forschungsinterviews
- Rekrutierung und Stichprobenauswahl für Forschungsinterviews
- Interview Design
- Wie man Interviewfragen formuliert
- Vertrauensverhältnis in Interviews
- Soziale Erwünschtheit
- Interviewer-Effekt
- Arten von Forschungsinterviews
- Persönliche Interviewforschung
- Fokusgruppen-Interviews
- E-Mail-Interviews
- Telefoninterviews
- Stimulierte Erinnerungsinterviews
- Interviews vs. Umfragen
- Interviews vs. Fragebögen
- Interviews und Verhöre
- Wie transkribiert man Interviews?
- Verbatim Transkription
- Saubere Interviewtranskriptionen
- Manuelle Transkription von Interviews
- Automatisierte Transkription von Interviews
- Wie kommentiert man Forschungsinterviews?
- Formatierung und Anonymisierung von Interviews
- Interviews analysieren
- Kodierung von Interviews
- Berichterstattung und Präsentation der Interviewergebnisse
- Wie man den „Leitfaden zur Interviewanalyse“ zitiert
Typen von Forschungsinterviews
Während die Durchführung von Interviews in der Forschung den gleichen Zweck verfolgt, nämlich die Sammlung von detaillierten Informationen über einen Teilnehmer oder ein Phänomen, ermöglichen verschiedene Methoden eine eingeschränkte oder freie Sammlung. Einige Interviews haben spezifische Fragen, während andere flexibler sind und improvisiert werden können. In diesem Artikel gehen wir auf die Feinheiten der verschiedenen Interviewtypen für die Forschung ein und erklären die Unterschiede zwischen strukturierten, unstrukturierten und halbstrukturierten Interviewmethoden.
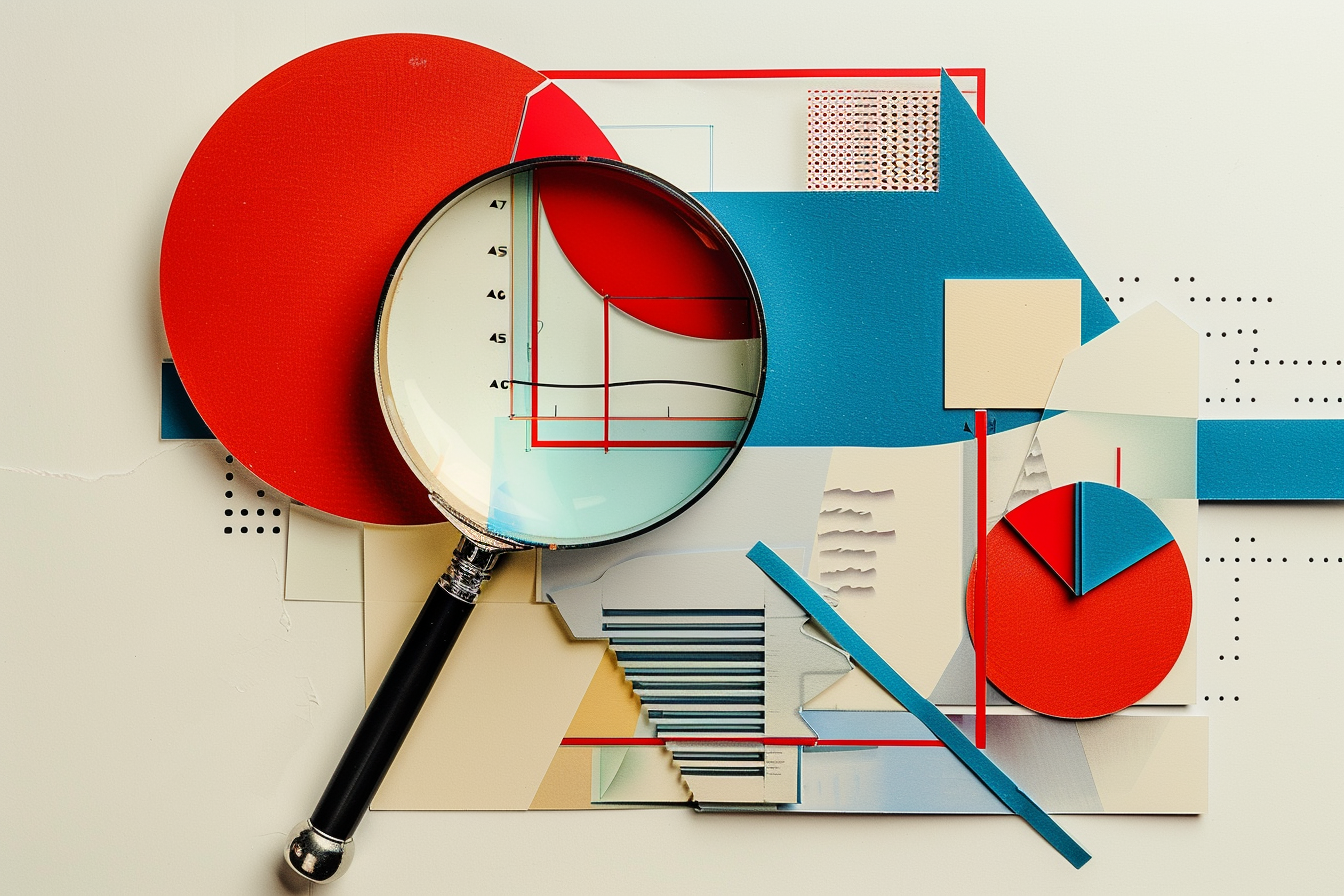
Einführung
Interviews sind eine gängige Methode der Datenerhebung in der qualitativen Forschung. Das Führen von Interviews dient als Rahmen, um Praktiken und Standards zu erfassen, zu hinterfragen und zu verstärken (Jamshed, 2014). Die meisten Interviews lassen sich in eine von drei Kategorien einteilen: das strukturierte, das halbstrukturierte oder das unstrukturierte Forschungsinterview. Diese strukturierten und unstrukturierten Interviews unterscheiden sich durch das Ausmaß, in dem sie sich auf vorher festgelegte Fragen stützen, und jeder Ansatz hat seine eigenen Stärken und Nachteile, auf die wir im Folgenden näher eingehen. Darüber hinaus erörtern wir auch andere Forschungsmethoden, wie z. B. Fokusgruppen, um einen weiteren Vergleichspunkt mit diesen drei Hauptformaten für individuelle Forschungsinterviews zu schaffen.
Ein strukturiertes Interview ist ideal für die Erhebung konsistenter und vergleichbarer Daten, während ein unstrukturiertes Interview einem freien Gespräch zwischen dem Forscher und dem Interviewteilnehmer ähnelt. Zwischen diesen beiden Extremen liegen die halbstrukturierten Interviews, die sowohl eine Reihe von im Voraus festgelegten Fragen mit Raum für Flexibilität als auch spontane Fragen kombinieren. Fokusgruppen ermöglichen es den Teilnehmern ebenfalls, sich offen zu äußern, aber aufgrund des Gruppencharakters sind Fokusgruppeninterviews eher für Studien geeignet, die sich mit Gruppendynamik oder kollektiver Bedeutungsgebung befassen. Angesichts der unterschiedlichen Stärken der einzelnen Forschungsmethoden sind sie in allen Forschungsbereichen zu finden, von Ethnographen, die bei ihrer langfristigen Feldforschung Interviews mit unstrukturierten Methoden durchführen, bis hin zu Forschern im Gesundheitswesen, die Interviews mit halbstrukturierten Ansätzen durchführen, um ein neues Thema systematisch zu untersuchen und zu erforschen.
Strukturierte Interviews
Strukturierte Interviews werden häufig in der qualitativen Forschung eingesetzt, wenn der Forscher eine kontrollierte, systematische Datenerhebung anstrebt. Diese Interviews folgen einem vorgegebenen Fragenkatalog, so dass sich der Interviewer und der Befragte auf bestimmte Themen konzentrieren können. Obwohl strukturierte Interviews nicht so flexibel sind wie freie, unstrukturierte Formate, haben sie einzigartige Vorteile, die sie für bestimmte Forschungskontexte geeignet machen.
Wann sind strukturierte Interviews am sinnvollsten?
Strukturierte Interviews eignen sich am besten für Forschungsarbeiten, die sich auf einen genau definierten theoretischen Rahmen stützen. In solchen Fällen kann der Interviewer die Fragen auf der Grundlage bestehender Forschungsarbeiten entwickeln und so sicherstellen, dass die neuen Daten auf vorherigem Wissen aufbauen. Diese Art von Interview ist besonders nützlich, wenn der Forscher weiß, welche Fragen wichtig sind und die Art der benötigten Informationen genau vorhersagen kann.
Im Gegensatz zu unstrukturierten Interviews, die offenere Antworten und bohrende Fragen zulassen, sind strukturierte Interviews darauf ausgelegt, spezifische Daten zu sammeln. Dieser Ansatz ist ideal, wenn das Ziel darin besteht, einheitliche, vergleichbare Antworten von mehreren Teilnehmern zu erhalten. Er ist weniger geeignet für Forschungszusammenhänge, die explorativ sind oder bei denen der Forscher nicht sicher ist, welche Fragen die nützlichsten Daten liefern könnten.
Vorteile strukturierter Interviews
Ein wesentlicher Vorteil strukturierter Interviews besteht darin, dass sie eine Fokussierung ermöglichen. Wenn das Gespräch einem strikten Fragenkatalog folgt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das Interview vom Thema abschweift. Indem sich der Interviewer an das Skript hält, stellt er sicher, dass das Gespräch relevant und auf die Forschungsziele ausgerichtet bleibt.
Strukturierte Interviews machen es auch einfacher, die Antworten verschiedener Teilnehmer zu vergleichen. Da allen die gleichen Fragen in der gleichen Reihenfolge gestellt werden, sind die gesammelten Daten einheitlich und lassen sich leichter auswerten. Diese Konsistenz ist ein großer Vorteil, vor allem wenn große Gruppen von Personen befragt werden. Die Forscher können die Antworten effizient gruppieren und nach Mustern oder Gemeinsamkeiten suchen.
Was die Logistik betrifft, so sind strukturierte Interviews oft einfacher zu organisieren. Da der Interviewer nicht improvisieren oder neue Fragen stellen muss, erfordert die Durchführung eines strukturierten Interviews weniger Geschick und Erfahrung. Interviewer können leicht darin geschult werden, einem vorformulierten Leitfaden zu folgen, so dass es für Forschungsteams machbar ist, diese Aufgabe an Assistenten zu delegieren.
Ein weiterer praktischer Vorteil ist, dass strukturierte Interviews relativ schnell durchgeführt werden können. Da es einen festen Satz von Fragen gibt, ist die Dauer eines jeden Interviews vorhersehbar, so dass es einfacher ist, mehrere Interviews in einem kurzen Zeitraum zu planen. Diese Effizienz ist wertvoll, wenn man mit großen Stichprobengrößen arbeitet.

Nachteile von strukturierten Interviews
Strukturierte Interviews haben auch ihre Grenzen. Der auffälligste Nachteil ist die mangelnde Flexibilität. Da die Fragen vorgegeben sind, kann der Interviewer keine bohrenden Fragen stellen oder die Antworten des Befragten vertiefen. Diese Starrheit kann den Interviewer daran hindern, die Perspektive des Teilnehmers vollständig zu verstehen, vor allem, wenn der Befragte eine vage oder zweideutige Antwort gibt.
Außerdem erfassen strukturierte Interviews möglicherweise nicht die Nuancen oder die Komplexität bestimmter Antworten. Jede Person kann dieselbe Frage anders interpretieren, und die Unmöglichkeit, Fragen zur Klärung oder weiteren Erkundung anzupassen, kann die Datenerhebung behindern. Im Gegensatz dazu ermöglichen unstrukturierte Interviews dynamischere Gespräche, bei denen der Interviewer die Fragen auf der Grundlage der individuellen Antworten des Befragten anpassen kann.
Die feste Reihenfolge der Fragen kann ebenfalls problematisch sein. Einige Fragen werden nicht von jedem Teilnehmer in gleicher Weise beantwortet. Beispielsweise kann eine Frage, die für einen Befragten sinnvoll ist, einen anderen verwirren. Bei einem unstrukturierten Format hat der Interviewer die Freiheit, Fragen auszulassen oder umzuformulieren, aber bei strukturierten Interviews muss er sich an das Skript halten.
Insgesamt besteht der größte Nachteil strukturierter Interviews darin, dass die Gefahr besteht, dass sich die Forschung auf den ursprünglichen Fragenkatalog beschränkt. Deshalb müssen die Forscher ihre Interviewfragen sorgfältig ausarbeiten und sicherstellen, dass sie alle notwendigen Themen abdecken. Es wird dringend empfohlen, Pilotversuche mit den Fragen durchzuführen, um eventuelle Probleme oder Lücken zu erkennen, bevor die eigentlichen Interviews beginnen.
Strukturierte Interviews vs. Umfragen
Strukturierte Interviews werden oft mit Umfragen mit offenen Fragen verglichen, da beide Methoden vorgegebene Fragen beinhalten. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede. Während mit Umfragen eine größere Anzahl von Befragten erreicht werden kann, bieten strukturierte Interviews mehr Möglichkeiten zur Klärung. Wenn ein Befragter Schwierigkeiten hat, eine Frage während eines Interviews zu verstehen, kann der Interviewer zusätzlichen Kontext oder Beispiele liefern, was bei einer Umfrage nicht möglich ist.
Ein weiterer Vorteil von strukturierten Interviews ist die zwischenmenschliche Interaktion zwischen Interviewer und Befragtem. Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist oft hilfreich um eine Beziehung aufbauen, wodurch sich die Befragten wohler fühlen und bereit sind, detaillierte Antworten zu geben. Im Gegensatz dazu können Umfragen, insbesondere schriftliche, als unpersönlich empfunden werden und nicht die gleiche Tiefe der Antworten hervorrufen.
Interviews führen im Vergleich zu Umfragen in der Regel auch zu umfassenderen, detaillierteren Antworten. Wenn die Teilnehmer über Themen von persönlicher Bedeutung sprechen, gibt ihnen das Interviewformat den Raum, ihre Gedanken zu vertiefen, während Umfragen ihre Antworten einschränken können.

Konzeption und Durchführung von strukturierten Interviews
Bei der Planung eines strukturierten Interviews spielt das Forschungsdesign eine entscheidende Rolle. Der Interviewleitfaden, der alle Fragen enthält, die der Interviewer stellen wird, sollte auf der Grundlage einer gründlichen Literaturübersicht sorgfältig entworfen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Fragen relevant sind und sich auf bestehende Forschungsergebnisse stützen.
Bei der Gestaltung des Interviews ist es wichtig, die Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen das Interview durchgeführt wird. Eine einheitliche Interviewumgebung kann dazu beitragen, externe Faktoren, die die Antworten der Befragten beeinflussen könnten, zu minimieren. So sollten die Interviews idealerweise in einer ruhigen, angenehmen Umgebung geführt werden, um eine offene Kommunikation zu ermöglichen.
Die Erstellung eines Interviewleitfadens beinhaltet die Ausarbeitung von Fragen, die mit den Forschungszielen und dem theoretischen Rahmen übereinstimmen. Die Anzahl der Fragen kann je nach der verfügbaren Zeit variieren, aber es ist wichtig, die Tiefe der Fragen mit der Länge des Interviews in Einklang zu bringen. Die Durchführung von Pilotinterviews hilft bei der Feinabstimmung der Fragen und der Ermittlung von Problemen, bevor die eigentliche Datenerhebung beginnt.
Sammeln und Analysieren von Daten
Datenerhebung in strukturierten Interviews ist unkompliziert. Der Interviewer zeichnet die Antworten auf, in der Regel mit einem Audiorecorder, in manchen Fällen auch mit einem Videogerät, um Körpersprache und Mimik eingehender zu analysieren. Nach dem Interview werden die Aufzeichnungen transkribiert und analysiert.
In der qualitativen Forschung ist die thematische Analyse eine gängige Methode zur Analyse von strukturierten Interviewdaten. Der Forscher identifiziert wiederkehrende Themen und kodiert die Antworten entsprechend. Da die Fragen in einer einheitlichen Reihenfolge gestellt werden, ist es einfach, die Antworten der verschiedenen Teilnehmer zu kategorisieren und zu vergleichen. Software-Tools wie ATLAS.ti können bei der Organisation und Kodierung der Daten helfen.
Halbstrukturierte Interviews
Halbstrukturierte Interviews sind eine wirksame Methode in der qualitativen Forschung, die mehr Flexibilität als strukturierte Interviews zulässt, aber dennoch einen Rahmen bietet, um das Gespräch zu lenken. Dieses Format ermöglicht es den Forschern, tiefer in die Sichtweise der Befragten einzudringen, bietet die Freiheit, Folgefragen zu stellen, und stellt dennoch sicher, dass die wesentlichen Themen abgedeckt werden.
Vorteile von halbstrukturierten Interviews
Der Hauptvorteil von halbstrukturierten Interviews ist die Möglichkeit, die Antworten der Befragten zu vertiefen. Im Gegensatz zu strukturierten Interviews, bei denen die Fragen und die Reihenfolge festgelegt sind, halbstrukturierte interviews kann der Interviewer auf interessante oder unerwartete Punkte eingehen. Diese Flexibilität trägt dazu bei, reichhaltigere und detailliertere Informationen zu erhalten, die einen tieferen Einblick in das Forschungsthema geben können.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die vorgegebenen Fragen trotz der Flexibilität eine Struktur vorgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die für die Forschung relevanten Schlüsselthemen gründlich erforscht werden, auch wenn das Gespräch in unterschiedliche Richtungen geht. Das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Struktur macht halbstrukturierte Interviews besonders nützlich für Studien, bei denen eine Kombination aus Tiefe und Fokus erforderlich ist.
Nachteile halbstrukturierter Interviews
Der offene Charakter von halbstrukturierten Interviews kann jedoch auch ein Nachteil sein. Da das Gespräch manchmal vom Thema abschweifen kann, muss der Interviewer darauf achten, dass die Diskussion auf die Forschungsfrage abgestimmt ist. Wenn das Gespräch zu sehr abweicht, sind die gesammelten Daten möglicherweise nicht relevant für die Forschungsziele, was zu Problemen bei der Analyse führt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass halbstrukturierte Interviews einen engagierteren Interviewer erfordern. Aktives Zuhören ist entscheidend, um Gelegenheiten für weitere Fragen zu erkennen, was bedeutet, dass die Interviewer ausreichend geschult werden müssen. Unerfahrenen Interviewern kann es schwer fallen, das Gleichgewicht zwischen dem Fluss des Gesprächs und der Konzentration auf die Forschungsziele zu halten. Dies verleiht dem Interviewprozess eine zusätzliche Komplexität, die in strukturierteren Formaten nicht gegeben ist.

Wann sollte ein halbstrukturiertes Interview verwendet werden?
Halbstrukturierte Interviews sind vor allem dann sinnvoll, wenn ein Forscher individuelle Erfahrungen und Perspektiven zu einem bestimmten Thema erforschen möchte. Dieses Format ist besonders nützlich bei der Entwicklung von Theorien in Bereichen, in denen die vorhandene Literatur keine theoretische Kohärenz aufweist. Da sich das Gespräch an die Einsichten des Befragten anpassen kann, ermöglicht das halbstrukturierte Interview den Forschern eine tiefere Auseinandersetzung mit den aufkommenden Ideen.
Forscher, die halbstrukturierte Interviews verwenden, sollten eine klare Agenda und spezifische Forschungsziele haben, um sicherzustellen, dass die Interviews fokussiert bleiben. Diese Ziele dienen als Richtschnur für die Kernfragen, die den Befragten gestellt werden, lassen aber dennoch Spielraum für weitere Untersuchungen. In Studien, die darauf abzielen, persönliche Erfahrungen zu erforschen oder Theorien aufzustellen, ist das halbstrukturierte Format ideal, da es ermöglicht, die Ideen der Befragten zu erforschen, ohne die Forschungsziele aus den Augen zu verlieren.
Best Practices für die Durchführung halbstrukturierter Interviews
Die erfolgreiche Durchführung eines halbstrukturierten Interviews erfordert sorgfältige Planung und Absicht in jeder Phase, von der Auswahl der Teilnehmer bis zur Gestaltung der Fragen. Die Auswahl von Teilnehmern, die für das Forschungsthema geeignet sind, ist entscheidend. Wenn sich die Untersuchung beispielsweise auf eine bestimmte kulturelle Praxis konzentriert, werden Befragte mit direkter Erfahrung oder Kenntnis dieser Praxis die relevantesten Daten liefern.
Es ist auch wichtig, sich gründlich auf die Interaktion vorzubereiten. Forscher sollten es vermeiden, bei ihren Fragen Jargon oder eine zu komplexe Sprache zu verwenden, und sie sollten ihre Sprache an den Hintergrund der Befragten anpassen. Je nachdem, ob es sich bei den Befragten um Erwachsene, Kinder oder Sprecher verschiedener Sprachen handelt, sollte der Ansatz angepasst werden, damit das Gespräch zugänglich und produktiv bleibt.
Die Forscher sollten auch die für die Datenerhebung verwendete Ausrüstung berücksichtigen. Während der Audiorekorder eines Smartphones für die meisten Interviews ausreicht, kann in lauteren Umgebungen oder wenn nuanciertere Daten wie Körpersprache oder Mimik für die Analyse wichtig sind, eine professionelle Ausrüstung erforderlich sein.

Ausarbeitung halbstrukturierter Interviewfragen
Die Ausarbeitung eines Interviewleitfadens ist für die Durchführung halbstrukturierter Interviews von entscheidender Bedeutung. Der Leitfaden sollte zwar die wichtigsten Fragen und Themen auflisten, aber auch flexibel genug sein, um einen natürlichen Gesprächsverlauf zu ermöglichen. Die Fragen sollten offen formuliert sein, um zu ausführlichen Antworten einzuladen und zu vermeiden, dass sozial erwünschte Antworten hervorgerufen werden.
Die Forscher sollten außerdem im Voraus Folgefragen oder Testfragen vorbereiten. Diese können die Befragten dazu ermutigen, ihre Antworten zu vertiefen oder unklar erscheinende Punkte zu klären. Probefragen helfen, die Herausforderung kurzer oder unengagierter Antworten zu überwinden, indem sie die Teilnehmer auffordern, ihre Gedanken zu vertiefen.
Sammlung und Analyse von Daten aus halbstrukturierten Interviews
Während und nach dem Interview müssen die Forscher sicherstellen, dass sie die qualitativen Daten rigoros sammeln. Der gängigste Ansatz ist die Transkription der Interviewgespräche. Qualitativ hochwertige Aufnahmen sind für eine genaue Transkription unerlässlich, und es ist oft von Vorteil, Transkriptionssoftware oder professionelle Dienste zu nutzen, um den Prozess zu optimieren.
Sobald die Daten transkribiert sind, können sie mit qualitativer Datenanalysesoftware wie ATLAS.ti analysiert werden. Die Software hilft beim Organisieren und Analysieren der Daten. Das Kodieren beginnt in der Regel mit dem Ordnen der Antworten nach den Fragen des Interviewleitfadens, wodurch der Forscher die Antworten der verschiedenen Teilnehmer vergleichen kann. Zusätzliche Kodierung auf der Grundlage von aufkommenden Themen kann tiefere Einblicke in die Daten liefern.
Neben der Kodierung sollten die Forscher auch Notizen während und nach dem Interview anfertigen. Diese Notizen können wichtige Beobachtungen über die Interaktion festhalten, die im Transkript allein möglicherweise nicht ersichtlich sind. So können beispielsweise nonverbale Hinweise wie Körpersprache oder Tonfall den verbalen Antworten wertvollen Kontext hinzufügen.
Halbstrukturierte Interviews für die Analyse vorbereiten
Sobald ein Interview abgeschlossen ist, hört der Forschungsprozess nicht mit der Transkription auf. Die Forscher müssen die gesammelten Daten sorgfältig analysieren, um Themen und Muster zu identifizieren, die für ihre Forschungsfragen relevant sind. Die Genauigkeit der Transkription ist für eine gründliche Analyse von entscheidender Bedeutung, und die Forscher möchten möglicherweise Details wie Pausen oder Denkgeräusche einbeziehen, wenn sie für die Studie relevant sind.
Nach der Transkription hilft die Kodierung dabei, die Daten in sinnvolle Kategorien einzuteilen. Dieser Prozess hilft den Forschern, Muster in den Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmer zu erkennen, was ein tieferes Verständnis des Forschungsthemas ermöglicht.
Unstrukturierte Interviews
Unstrukturierte Interviews, die oft auch als nicht-direktive Interviews bezeichnet werden, sind sehr gesprächig und flexibel. Bei dieser Methode kann der Interviewer ein allgemeines Thema vorgeben, aber er lässt das Gespräch natürlich verlaufen und ermutigt die Teilnehmer, ihre Gedanken und Erfahrungen frei zu äußern. Unstrukturierte Interviews eignen sich besonders gut für die Erkundung neuer oder komplexer Forschungsthemen Themen, bei denen der Forscher unerwartete Erkenntnisse gewinnen möchte. Der offene Charakter dieser Interviews kann reichhaltige, detaillierte Daten liefern, aber das Fehlen einer Struktur kann es schwierig machen, die Antworten der verschiedenen Teilnehmer zu vergleichen, und kann zu einem zeitaufwändigeren Datenerfassungsprozess führen.
Wann sollten unstrukturierte Interviews verwendet werden?
Unstrukturierte Interviews eignen sich besonders gut für explorative Forschung, wenn das Ziel darin besteht, ein tiefes Verständnis eines Phänomens zu entwickeln, vor allem, wenn es nur wenige bestehende Theorien gibt, die die Forschung leiten. Dieser Ansatz wird häufig in Studien verwendet, die darauf abzielen, "dichte Beschreibungen" (thick descriptions) zu sammeln, ein Begriff, der sich auf die detaillierte Erforschung der Perspektiven eines Befragten bezieht, um die Komplexität sozialer Phänomene zu verstehen.
Bei Studien zu sensiblen Themen wie Hospizpflege oder Migrantenarbeit zögern die Befragten möglicherweise eher, sich zu öffnen, wenn sie mit direkten oder strukturierten Fragen konfrontiert werden. Unstrukturierte Interviews ermöglichen es den Forschern, eine Beziehung zu den Teilnehmern aufzubauen und ein angenehmeres Umfeld zu schaffen, in dem sie ihre Gedanken und Erfahrungen offen mitteilen können.
Wenn das Hauptziel darin besteht, Vertrauen und eine gute Beziehung aufzubauen, sind unstrukturierte Interviews eine effektive Möglichkeit, die Teilnehmer einzubeziehen. Da es keine starre Struktur gibt, kann das Gespräch natürlicher verlaufen, so dass sich die Befragten wohler fühlen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, aussagekräftige Daten zu sammeln.
Vorteile unstrukturierter Interviews
Einer der Hauptvorteile unstrukturierter Interviews ist ihr offener Charakter, der es dem Gespräch erlaubt, in jede Richtung zu gehen, die sich auf natürliche Weise ergibt. Während der Interviewer in der Regel ein klares Forschungsziel hat, gibt das Fehlen einer starren Struktur den Befragten mehr Kontrolle über die Interaktion. Dies kann sie dazu ermutigen, detailliertere und tiefgründigere Antworten zu geben, insbesondere wenn sensible Themen oder persönliche Erfahrungen besprochen werden.
Die Freiheit, die Perspektiven der Befragten eingehender zu erforschen, macht unstrukturierte Interviews ideal für Studien, die reichhaltige, qualitative Daten sammeln wollen. Die Forscher können ein nuancierteres Verständnis der Ansichten, sozialen Gepflogenheiten oder kulturellen Praktiken der Befragten gewinnen, insbesondere in Bereichen, in denen das vorhandene Wissen begrenzt ist.

Nachteile von unstrukturierten Interviews
Trotz ihrer Vorteile sind unstrukturierte Interviews mit einigen Herausforderungen verbunden. Einer der Hauptnachteile ist die Schwierigkeit, die von verschiedenen Teilnehmern erhobenen Daten zu analysieren und zu vergleichen. Da sich jeder Befragte auf unterschiedliche Aspekte des Themas konzentrieren kann, können die Daten vielfältig und weniger konsistent sein, was es schwierig macht, verschiedene Perspektiven in eine kohärente Analyse zu integrieren.
Ein weiterer potenzieller Nachteil ist das Risiko, dass sich das Gespräch zu weit vom Forschungsthema entfernt. Da es keine vorgegebenen Fragen gibt, muss der Interviewer den Gesprächsfluss sorgfältig steuern, um sicherzustellen, dass wertvolle Informationen gesammelt werden. Wenn der Interviewer den Fokus verliert, kann das Gespräch in unzusammenhängende Richtungen abschweifen, was zu irrelevanten Daten führt.
Unstrukturiertes Interview
Obwohl unstrukturierte Interviews nicht nach einem festen Fragenkatalog ablaufen, erfordern sie dennoch eine sorgfältige Planung. Der Interviewer sollte ein klares Verständnis des Forschungsthemas und der Ziele haben, die er erreichen möchte. Auch wenn es keine spezifischen Fragen gibt, die das Interview leiten, sollte der Interviewer eine Reihe von Schlüsselthemen haben, die er während des Gesprächs erkunden möchte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt unstrukturierter Interviews ist die Fähigkeit des Interviewers, sich dem Gespräch in Echtzeit anzupassen. Das bedeutet, dass er wissen muss, wann er bohrende Fragen stellen und wann er dem Befragten die Führung des Gesprächs überlassen sollte. Die Fähigkeit, soziale Signale zu erkennen und die Fragestellung an das Wohlbefinden des Befragten anzupassen, ist für eine erfolgreiche Datenerhebung in diesem Format unerlässlich.
Die Phase der Datenerhebung in unstrukturierten Interviews kann einer der dynamischsten Aspekte des Forschungsprozesses sein. Da es kein vorher festgelegtes Skript gibt, muss der Interviewer das Gespräch mit Sorgfalt führen und den Befragten ermutigen, ausführliche Erzählungen zu geben. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses ist von entscheidender Bedeutung, da es ein Umfeld fördert, in dem sich die Befragten wohlfühlen, wenn sie ihre Gedanken offen diskutieren.
Der Interviewer sollte darauf abzielen, detaillierte Berichte von den Befragten zu erhalten, und gleichzeitig Leitfragen vermeiden, die ihre Antworten beeinflussen könnten. Mit einfachen, nicht bedrohlichen Fragen zu beginnen, ist eine gute Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen, bevor man zu komplexeren oder sensibleren Themen übergeht.
Wie analysiert man unstrukturierte Interviews?
Die Analyse unstrukturierter Interviewdaten erfordert einen systematischen Ansatz, um den Sinn der oft sehr unterschiedlichen Antworten zu verstehen. In der Regel werden die Interviewdaten transkribiert, so dass der Forscher nach wichtigen Sätzen, Mustern oder Erkenntnissen suchen kann. Qualitative Datenanalyse-Software wie ATLAS.ti kann bei der Organisation und Kodierung der Daten helfen. Die Software hilft den Forschern, Schlüsselthemen zu identifizieren und die Antworten der verschiedenen Teilnehmer zu vergleichen.
Kodierung ist ein wesentlicher Teil des Analyseprozesses. Forscher können mit der Erstellung einer Liste vorläufiger Codes auf der Grundlage ihrer Forschungsfragen beginnen, sollten aber während der Analyse der Daten offen für neue Codes bleiben. Sie könnten zum Beispiel eine thematische Analyse durchführen, bei der wiederkehrende Themen oder gemeinsame Erfahrungen der Befragten identifiziert werden.
Unstrukturierte Interviews können auch durch diskursive Kodierung analysiert werden, die sich darauf konzentriert, wie die Befragten über ein bestimmtes Phänomen sprechen. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn das Ziel darin besteht, zu erforschen, wie Einzelpersonen eine Bedeutung rund um das Thema von Interesse konstruieren.
Schwerpunktgruppen
Eine Fokusgruppe in der Forschung ist eine qualitative Methode, bei der eine kleine Gruppe von Personen an einer Diskussion teilnimmt, die von einem Moderator geleitet wird. Fokusgruppen sind interaktiv und ermöglichen den Teilnehmern, ihre Meinungen und Perspektiven zu einem Thema, einem Produkt oder einer Dienstleistung mitzuteilen. Diese Methode wird häufig in der Marktforschung und in den Sozialwissenschaften eingesetzt, um soziales Verhalten und Gruppendynamik auf eine Weise zu beobachten, wie es bei Einzelinterviews oder Beobachtungen nicht möglich ist.

Zweck einer Fokusgruppe
Der Hauptzweck einer Fokusgruppe besteht darin, verschiedene Standpunkte und Meinungen zu sammeln, die sich in einem Gruppenumfeld herausbilden. Fokusgruppen sind besonders nützlich in Situationen, in denen Forscher verstehen müssen, wie Menschen miteinander interagieren, während sie über ein Thema diskutieren. Sie können eingesetzt werden, um neue Ideen zu erforschen, Konzepte zu testen oder Einblicke in soziale Verhaltensweisen zu gewinnen. Die dynamische Interaktion zwischen den Teilnehmern ermöglicht es den Forschern, zu beobachten, wie sich Meinungen in einem sozialen Umfeld bilden und weiterentwickeln.
Größe und Zusammensetzung von Fokusgruppen
Eine typische Fokusgruppe besteht aus 6 bis 10 Teilnehmern, die von einem Moderator geleitet werden. Diese Größe ermöglicht ein breites Spektrum an Perspektiven und stellt sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Beitrag zu leisten. Zu wenige Teilnehmer können die Meinungsvielfalt einschränken, während zu viele Teilnehmer es schwierig machen können, die Diskussion zu steuern und sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört werden.
Wie Fokusgruppen funktionieren
Fokusgruppen beinhalten in der Regel eine Reihe von offenen Fragen, die im Voraus vom Forscher vorbereitet werden. Diese Fragen dienen als Anregung für die Diskussion und leiten die Teilnehmer dazu an, ihre Gedanken zum jeweiligen Thema mitzuteilen. Die Fragen sind weit gefasst und nicht direktiv, so dass die Teilnehmer sich frei in ihren eigenen Worten ausdrücken können. Die Rolle des Moderators besteht darin, das Gespräch am Laufen zu halten, bei Bedarf weitere Details zu erfragen und sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zu leisten.
Effektivität von Fokusgruppen
Was Fokusgruppen besonders effektiv macht, ist die soziale Interaktion zwischen den Teilnehmern. Im Gegensatz zu Einzelinterviews können die Forscher bei Fokusgruppen beobachten, wie die Meinungen durch die Gruppendynamik beeinflusst werden. Das Hin und Her in der Diskussion kann neue Ideen anregen, Übereinstimmungen oder Unstimmigkeiten aufzeigen und deutlich machen, wie Menschen verhandeln und einen Konsens finden. Diese Interaktionen bieten tiefere Einblicke nicht nur in das, was die Menschen denken, sondern auch wie und warum sie bestimmte Ansichten vertreten.
Fokusgruppen sind vielseitig und können in einem breiten Spektrum von Forschungskontexten eingesetzt werden. Besonders wertvoll sind sie in der explorativen Forschung, wo es darum geht, ein erstes Verständnis für ein neues oder komplexes Thema zu gewinnen. Der interaktive Charakter von Fokusgruppen hilft den Forschern, Schlüsselthemen zu identifizieren, Forschungsvorschläge zu entwickeln und ihr Verständnis für den Forschungsgegenstand zu vertiefen. Dieser Ansatz ist auch nützlich, um neue Ideen in Bereichen wie Produktentwicklung, Politikgestaltung und Programmdesign zu entwickeln.
Neben der Ideenfindung helfen Fokusgruppen den Forschern, die Sprache und Terminologie zu verstehen, die die Teilnehmer verwenden, wenn sie über ein Thema diskutieren. Diese Erkenntnisse können für die Entwicklung von Umfragen, die Interpretation qualitativer Daten oder das Verständnis der Bedeutung, die Menschen ihren Erfahrungen beimessen, entscheidend sein.
Schlussfolgerung
Verschiedene Arten von Interviews bieten unterschiedliche Vorteile und Herausforderungen, die jeweils für bestimmte Forschungsziele und -kontexte geeignet sind. Strukturierte Interviews bieten Konsistenz und Vergleichbarkeit und sind daher ideal für Studien, die eine standardisierte Datenerhebung erfordern. Halbstrukturierte Interviews schaffen ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Struktur und ermöglichen es den Forschern, Schlüsselthemen zu erforschen und gleichzeitig tiefer in die Perspektive der Befragten einzudringen. Unstrukturierte Interviews bieten die größte Flexibilität und ermöglichen es den Forschern, reichhaltige, tiefgehende Daten in einem offenen und gesprächigen Format zu sammeln, was besonders in der explorativen Forschung nützlich ist. Die Wahl des richtigen Interviewtyps hängt von den Forschungszielen, der Art des Themas und der gewünschten Tiefe der Datenerhebung ab, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode mit den Anforderungen der Studie zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse übereinstimmt.
Referenzen
- Jamshed S. (2014). Qualitative Forschungsmethode - Befragung und Beobachtung. Journal of basic and clinical pharmacy, 5(4), 87-88. https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942