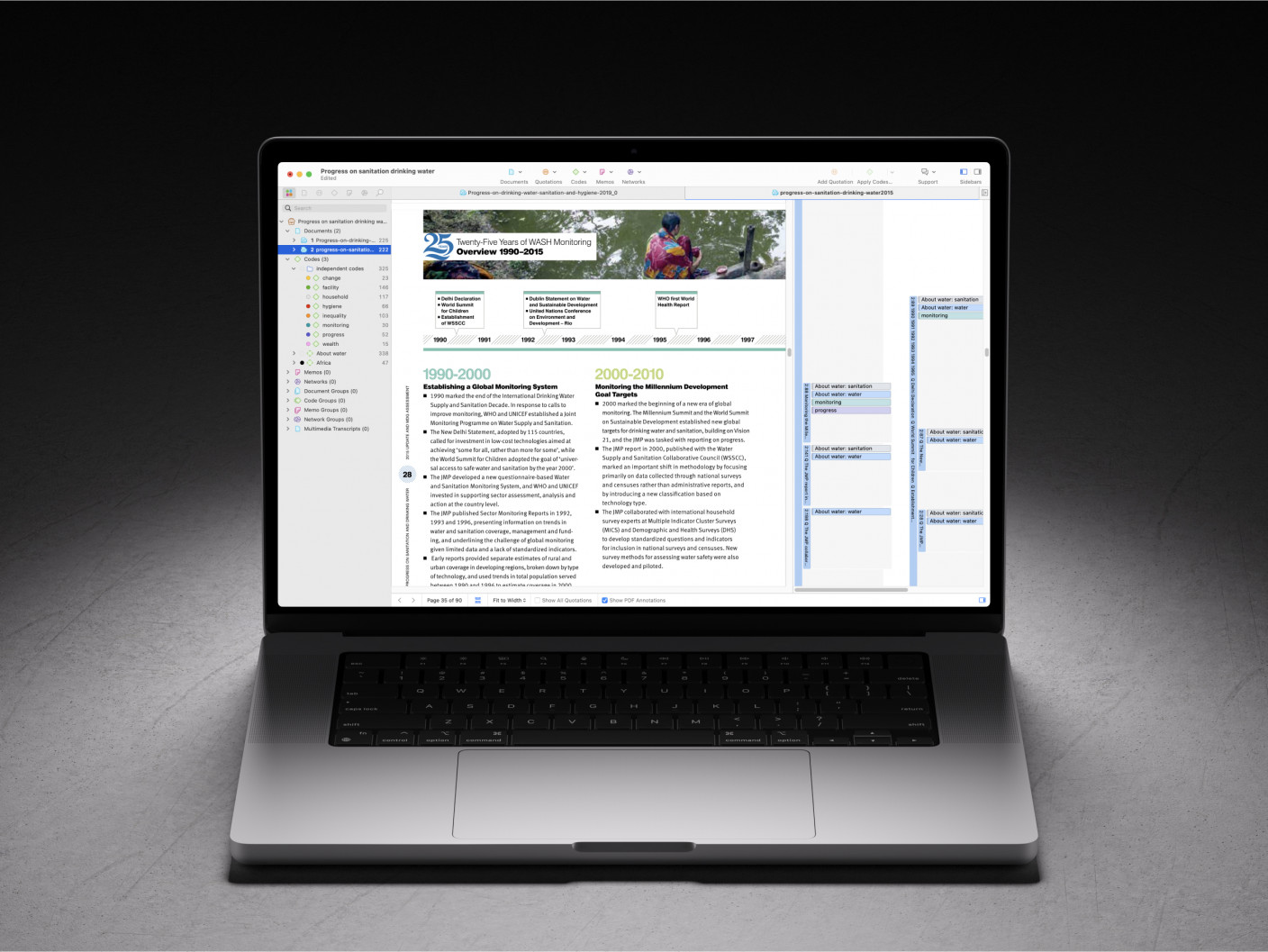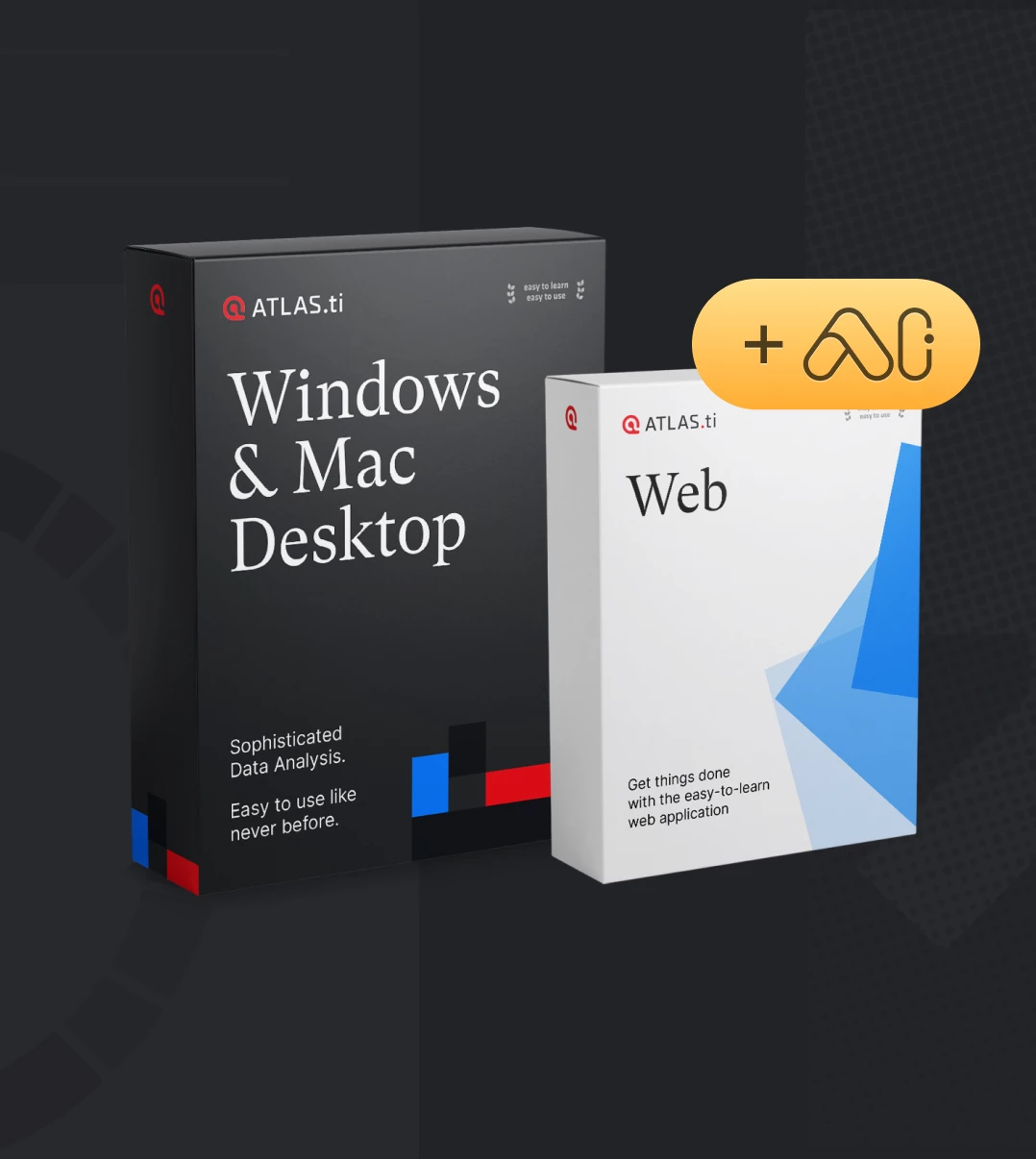Der Leitfaden zur Interviewanalyse
- Was ist eine Interviewanalyse?
- Vorteile von Interviews in der Forschung
- Nachteile von Interviews in der Forschung
- Ethische Überlegungen bei Interviews
- Vorbereitung eines Forschungsinterviews
- Rekrutierung und Stichprobenauswahl für Forschungsinterviews
- Interview Design
- Wie man Interviewfragen formuliert
- Vertrauensverhältnis in Interviews
- Soziale Erwünschtheit
- Interviewer-Effekt
- Arten von Forschungsinterviews
- Persönliche Interviewforschung
- Fokusgruppen-Interviews
- E-Mail-Interviews
- Telefoninterviews
- Stimulierte Erinnerungsinterviews
- Interviews vs. Umfragen
- Interviews vs. Fragebögen
- Interviews und Verhöre
- Wie transkribiert man Interviews?
- Verbatim Transkription
- Saubere Interviewtranskriptionen
- Manuelle Transkription von Interviews
- Automatisierte Transkription von Interviews
- Wie kommentiert man Forschungsinterviews?
- Formatierung und Anonymisierung von Interviews
- Interviews analysieren
- Kodierung von Interviews
- Berichterstattung und Präsentation der Interviewergebnisse
- Wie man den „Leitfaden zur Interviewanalyse“ zitiert
Interviewer-Effekt
Der Interviewer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den die Eigenschaften, das Verhalten oder die Anwesenheit des Interviewers auf die Antworten der Interviewteilnehmer haben können. Es handelt sich um ein Konzept, das vor allem in den Sozialwissenschaften und der qualitativen Forschung untersucht wird, aber es kann bei jeder interviewbasierten Datenerhebung auftreten. Der Effekt kann zu falschen oder veränderten Daten führen, da die Teilnehmer aufgrund verschiedener Faktoren, die mit dem Interviewer zusammenhängen, unterschiedlich reagieren können. Dieser Artikel befasst sich mit dem Wesen des Interviewereffekts, seinen Auswirkungen auf die Forschungsqualität, den Methoden zu seiner Erkennung und den Strategien zu seiner Vermeidung.

Einführung
Der Interviewer-Effekt kann sich in verschiedenen Formen manifestieren und sowohl die Genauigkeit der Berichterstattung als auch die Qualität der erhobenen Daten beeinträchtigen. Merkmale des Interviewers wie Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Auftreten und Erfahrung können die Dynamik des Befragungsgesprächs prägen und dadurch beeinflussen, wie die Befragten bestimmte Fragen wahrnehmen und beantworten.
Die Eigenschaften der Interviewer spielen eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung von Fragen. So können beispielsweise weibliche Interviewer andere Antworten hervorrufen als männliche, insbesondere bei Themen wie Sexualverhalten oder rassistische Einstellungen. Ältere Interviewer könnten ungewollt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung auslösen, bei der die Befragten ihre Antworten an die Erwartungen anpassen, die sie aufgrund des Alters des Interviewers haben. Erfahrene Interviewer könnten sich geschickter bewegen unstrukturierte Interviews, was die Wahrscheinlichkeit von Interviewerfehlern verringert und die Datenqualität verbessert.
Der Interviewer-Effekt ist nicht nur auf traditionelle persönliche Interviews beschränkt. Er erstreckt sich auch auf Telefonumfragen, strukturierte Interviews, unstrukturierte Interviews und sogar auf selbst ausgefüllte Fragebögen. In der Marktforschung beispielsweise kann die Varianz der Interviewer zu inkonsistenten Umfragestatistiken führen, was die Gültigkeit der Ergebnisse untergräbt. Auch in der Politikwissenschaft können Interviewer-Effekte die Bewertung von politischem Wissen und Ethnien verzerren, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Erhebungsmethodik unterstreicht.
Was verursacht den Interviewer-Effekt?
Der Interviewer-Effekt entsteht durch verschiedene Faktoren, wie z. B. die Eigenschaften, das Verhalten und den Interaktionsstil des Interviewers, die die Qualität der erhobenen Daten beeinflussen können (West & Blom, 2017).
Merkmale des Interviewers
Es hat sich gezeigt, dass Merkmale des Interviewers wie Geschlecht, Alter, Ethnie und sozialer Status die Art und Weise beeinflussen, wie die Teilnehmer antworten. Die Teilnehmer könnten ihre Antworten ändern, um sie an das anzupassen, was sie aufgrund der demografischen Merkmale des Interviewers als sozial akzeptabel empfinden. Studien zeigen, dass die Befragten ihre Antworten eher an das anpassen, was ihrer Meinung nach erwartet wird, insbesondere wenn sie das Gefühl haben, dass der Interviewer eine Autorität oder eine gegenteilige Meinung vertritt. In der Zusammenfassung von West und Blom aus dem Jahr 2017 werden diese Einflüsse als entscheidend für das Verständnis der durch den Interviewer verursachten Variabilität in Umfragen bezeichnet. Die Auswirkungen der Ethnie des Interviewers wurden insbesondere in Bereichen wie politische Einstellungen und Rassenfragen untersucht.
Beispiel: Eine Studie zeigte, dass People of Colour (POC) dazu neigten, Fragen zur Rassengleichheit unterschiedlich zu beantworten, je nachdem, ob der Interviewer eine andere Person of Colour war oder nicht, und dass sie gegenüber Interviewern, die keine POC waren, günstigere Antworten gaben (Campbell, 1981).
Verhalten und Interaktion des Interviewers
Auch das verbale und nonverbale Verhalten der Interviewer kann die Antworten beeinflussen. Die Art und Weise, wie ein Interviewer eine Frage formuliert, sein Tonfall und sogar seine Körpersprache können die Befragten auf subtile Weise ermutigen, auf eine bestimmte Weise zu antworten. So kann beispielsweise ein zustimmendes Lächeln oder Nicken den Befragten dazu veranlassen, eine Antwort zu erweitern oder seine Antwort in die Richtung zu lenken, von der er glaubt, dass sie dem Interviewer gefällt. Untersuchungen von Groves und Couper (1998) zeigen, dass Interviewer, die maßgeschneiderte Antworten geben oder aktiver auf die Teilnehmer eingehen, unbeabsichtigt falsche Informationen einbringen können. Darüber hinaus kann das Ausmaß an Nachfragen und Feedback während des Gesprächs den Befragten helfen, ihre Gedanken zu klären oder sie zu einer bestimmten Antwort zu bewegen.
Beispiel: Interviewer, die bei offenen Fragen übermäßig viel nachfragen, um eine Klärung herbeizuführen, können am Ende die Tiefe oder den Umfang der Antworten beeinflussen, was zu längeren oder detaillierteren Antworten führt, als der Teilnehmer ursprünglich beabsichtigt hatte.
Die Anwesenheit des Interviewers
Selbst wenn Interviewer versuchen, neutral zu bleiben, kann ihre bloße Anwesenheit die Antworten der Teilnehmer beeinflussen, insbesondere bei persönlichen Gesprächen. Bei sensiblen Themen wie Sexualverhalten, Drogenkonsum oder kriminellen Handlungen können sich die Teilnehmer verunsichert oder beurteilt fühlen, was dazu führen kann, dass sie unerwünschte Verhaltensweisen herunterspielen oder sozial akzeptierte übertreiben. Untersuchungen haben ergeben, dass allein die Anwesenheit des Interviewers bei sozial sensiblen Themen ein wichtiger Faktor ist (Tourangeau & Smith, 1996).
Beispiel: In einer gesundheitsbezogenen Studie wurde festgestellt, dass die Befragten dazu neigen, Verhaltensweisen wie Rauchen oder Alkoholkonsum herunterzuspielen, wenn sie persönlich von einer Person befragt werden, die als gesundheitsbewusst oder autoritär wahrgenommen wird, weil sie ein Urteil oder eine soziale Stigmatisierung fürchten.
Kulturelle und soziale Erwartungen
Kulturelle Normen und soziale Hierarchien prägen die Interaktionen, insbesondere wenn der Interviewer als jemand mit einem anderen Hintergrund oder Status wahrgenommen wird. In Gesellschaften mit starken hierarchischen Strukturen kann es vorkommen, dass sich die Teilnehmer der vermeintlichen Autorität des Interviewers beugen und Antworten geben, die eher mit den erwarteten Ansichten des Interviewers übereinstimmen als mit ihren eigenen. Dies ist eine besonders häufige Herausforderung in der kulturübergreifenden Forschung, wo die Teilnehmer das Gefühl haben können, dass ihre wahren Ansichten nicht mit denen des Forschers übereinstimmen, und ihre Antworten entsprechend anpassen. Studien wie die von Durrant et al. (2010) legen nahe, dass ein Abgleich zwischen Interviewer und Teilnehmer nach Geschlecht, Ethnie oder kulturellem Hintergrund solche Effekte verringern könnte, auch wenn dies in großen Studien nicht immer möglich ist.
Beispiel: In einer Forschungsstudie in hierarchischen Kulturen könnten jüngere Teilnehmer davon absehen, sich kritisch zu sozialen oder politischen Themen zu äußern, wenn sie von jemandem befragt werden, der älter ist oder eine vermeintliche Autoritätsposition innehat.
Auswirkung des Interviewer-Effekts auf Forschungsprojekte
Der Interviewer-Effekt kann die Qualität qualitativer Daten erheblich beeinträchtigen und zu Messfehlern führen, die den wahren Charakter der Merkmale und Verhaltensweisen der Befragten verzerren.
Eine der tiefgreifendsten Auswirkungen des Interviewereffekts betrifft die Datenqualität. Der Interviewer-Effekt kann zu sozial erwünschten Verzerrungen führen, bei dem die Befragten Antworten geben, die sie für akzeptabler halten, als ihre wahren Gefühle oder Verhaltensweisen. Wenn beispielsweise über sexuelle Gesundheit oder sexuelles Verhalten gesprochen wird, können die Befragten je nach Einschätzung oder Erwartung des Interviewers zu wenig oder zu viel über ihre Aktivitäten berichten. Diese Verzerrung führt zu Messfehlern, die die abhängige Variable und die Gesamtintegrität der Forschungsergebnisse erheblich beeinträchtigen können.
Der Interviewer-Effekt ist besonders ausgeprägt bei Umfragen zu sensiblen Themen wie Sexualverhalten, Drogenkonsum oder Ethnie-bezogenen Einstellungen. Die Befragten ändern ihre Antworten möglicherweise so, dass sie mit dem übereinstimmen, was der Interviewer ihrer Meinung nach erwartet, vor allem, wenn zwischen ihnen ein erheblicher Alters- oder Geschlechtsunterschied besteht. Dieses Phänomen kann zu inkonsistenten Daten führen, bei denen männliche und weibliche Befragte abweichende Antworten geben, die nicht allein auf ihrem tatsächlichen Verhalten beruhen, sondern durch die Merkmale des Interviewers beeinflusst werden.
Interviewerfehler können den Interviewereffekt noch verstärken. Missverständnisse, falsche Fragen oder eine unangemessene Körpersprache können zu Antworteffekten führen, bei denen sich die Anwesenheit und das Verhalten des Interviewers direkt auf die Antworten der Befragten auswirken. Solche Fehler untergraben die Repräsentation der gesamten Bevölkerung und führen zu verzerrten Forschungsberichten und unzuverlässigen Schlussfolgerungen.

Wie kann man den Interviewer-Effekt erkennen?
Das Erkennen des Interviewer-Effekts ist für Forscher, die die Datenerhebungverbessern und die Integrität ihrer Ergebnisse sicherstellen möchten, von entscheidender Bedeutung. Verschiedene Indikatoren und Methoden können dabei helfen, diesen Effekt zu erkennen. Mehrere Indikatoren und Methoden können bei der Erkennung dieses Effekts helfen.
Interviewer-Varianz kann durch die Untersuchung der Konsistenz der Antworten verschiedener Interviewer bewertet werden. Eine signifikante Variabilität in den Umfragedaten, die auf verschiedene Interviewer zurückzuführen ist, deutet auf das Vorhandensein des Interviewereffekts hin. Mit Hilfe statistischer Verfahren, wie z. B. glaubwürdigen Intervallen und mehrstufigen Modellen, kann das Ausmaß der durch den Interviewer verursachten Varianz in den Daten quantifiziert werden.
Forscher können Korrelationen zwischen Interviewermerkmalen (z. B. Alter, Geschlecht, Erfahrung) und den Antworten der Befragten untersuchen. Beispielsweise kann ein konsistentes Muster, bei dem ältere Interviewer mit einer geringeren Berichterstattung über sexuelle Aktivitäten bei jüngeren Befragten in Verbindung gebracht werden, auf einen Interviewereffekt hindeuten. Solche Muster bedürfen weiterer Untersuchungen und möglicher Anpassungen des Befragungsdesigns.
Der Vergleich der Ergebnisse mit anderen Datenquellen oder die Verwendung von Grounded Theory Ansätzen kann helfen, das Vorhandensein des Interviewereffekts zu bestätigen. Diskrepanzen zwischen verschiedenen Datenerhebungsmethoden, wie z. B. Telefoninterviews gegenüber persönlichen Interviews, können zugrundeliegende, vom Interviewer verursachte Fehler aufzeigen.
Minimierung des Interviewer-Effekts
Die Strategien zur Minimierung des Interviewereffekts sind entscheidend für die Verbesserung der Validität der durch Interviews erhobenen Daten. Diese Strategien werden von Forschern wie West und Blom (2017), Groves und Couper (1998) und anderen weitgehend unterstützt. Hier finden Sie eine ausführlichere Erklärung der wichtigsten Strategien:
- Interviewerschulung: Es ist wichtig, dass die Interviewer geschult werden, damit sie in ihrem Tonfall, ihren Formulierungen und ihrem nonverbalen Verhalten Neutralität wahren. Indem man ihnen beibringt, wie man Suggestivfragen vermeidet, wertende Reaktionen reduziert und einen strukturierten Ansatz verfolgt, können die Forscher die von den einzelnen Interviewern eingebrachte Variabilität begrenzen. Diese Schulung stellt sicher, dass die Interviewer in ihrer Interaktion mit den Teilnehmern konsistent bleiben.
- Standardisierte Interviewprotokolle: Durch die Verwendung strukturierter oder halbstrukturierter Interviewleitfäden wird sichergestellt, dass alle Interviewer die gleichen Fragen auf die gleiche Weise stellen. Dies verhindert persönliche Interpretationen der Fragen oder des Tons und minimiert Fehler. Standardisierte Protokolle sind besonders bei groß angelegten Studien nützlich, um die Konsistenz der Interviews zu gewährleisten.
- Zuordnung von Interviewern zu Teilnehmern: In einigen Fällen kann die Zuordnung von Interviewern zu Teilnehmern auf der Grundlage gemeinsamer demografischer Merkmale (wie Geschlecht oder Ethnie) dazu führen, dass sich die Teilnehmer wohler fühlen. Auch wenn diese Strategie dazu beiträgt, das Unbehagen bei sensiblen Themen zu verringern, muss sie sorgfältig umgesetzt werden, um zu vermeiden, dass falsche Informationen, wie etwa Annahmen über gemeinsame Ansichten, eingeführt werden.
- Minimierung von nonverbalen Hinweisen: Interviewer sind darin geschult, nonverbale Kommunikation wie Mimik, Gestik oder Körpersprache, die die Teilnehmer ungewollt beeinflussen könnte, zu begrenzen. Die Neutralität dieser Hinweise trägt dazu bei, dass sich die Teilnehmer nicht gelenkt oder beurteilt fühlen, insbesondere bei persönlichen Gesprächen, bei denen die nonverbale Kommunikation von Bedeutung sein kann.
- Verwendung von Technologie: Tools wie die computergestützte Befragung (CAI) helfen, die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, zu standardisieren. Diese Systeme stellen sicher, dass die Interviewer einem Skript genau folgen, wodurch das Potenzial für durch den Interviewer verursachte Effekte verringert wird, da persönliche Interpretationen ausgeschlossen werden und die Konsistenz der Fragen gewährleistet ist.
- Blindheit der Interviewer gegenüber den Studienhypothesen: Indem die Interviewer über die spezifischen Forschungsziele im Unklaren gelassen werden, wird verhindert, dass sie die Teilnehmer bewusst oder unbewusst in Richtung bestimmter Antworten lenken. Diese Verblendungsstrategie trägt dazu bei, die Objektivität des Datenerhebungsprozesses zu wahren.
Schlussfolgerung
Der Interviewer-Effekt stellt in der qualitativen und interviewbasierten Forschung eine große Herausforderung dar, da er das Potenzial hat, ungenaue Informationen einzubringen und die Authentizität der erhobenen Daten zu verändern. Die Erkenntnis, dass die Eigenschaften, das Verhalten und sogar die bloße Anwesenheit des Interviewers die Antworten der Teilnehmer beeinflussen können, ist entscheidend für die Verbesserung der Datenqualität. Wenn Forscher die Ursachen und Erscheinungsformen des Interviewereffekts verstehen, können sie Strategien anwenden, die dessen Auswirkungen minimieren und so zuverlässigere und validere Ergebnisse gewährleisten.
Eine wirksame Schulung der Interviewer, die Verwendung standardisierter Protokolle und eine sorgfältige Abstimmung der Interviewer auf die Teilnehmer sind entscheidend, um den Einfluss des Interviewereffekts zu verringern. Darüber hinaus können der Einsatz von Technologien wie computergestützter Befragung (CAI) und die Wahrung der Neutralität des Interviewers das Fehlerpotenzial weiter verringern. Indem sie diese Faktoren proaktiv angehen, können Forscher die Integrität ihrer Forschungsprojekte verbessern, so dass die wahren Stimmen der Teilnehmer zum Vorschein kommen und zu genaueren Darstellungen der untersuchten sozialen Phänomene führen. Auf diese Weise verbessert der Forscher nicht nur die Qualität der Daten, sondern stellt auch sicher, dass die gezogenen Schlussfolgerungen sowohl aussagekräftig als auch vertrauenswürdig sind, und trägt damit letztlich zum Wissenszuwachs in den Sozialwissenschaften bei.
Referenzen
- West, B. T., & Blom, A. G. (2017). Explaining Interviewer effects: A research synthesis. Journal of Survey Statistics and Methodology, 5(2), 175-211.
- Campbell, A. L. (1981). Das Gefühl des Wohlbefindens in Amerika: Aktuelle Muster und Trends. McGraw-Hill.
- Groves, R. M., & Couper, M. P. (1998). Nonresponse in Haushaltsbefragungen. Wiley.
- Tourangeau, R., & Smith, T. W. (1996). Asking sensitive questions: The impact of data collection mode, question format, and question context. Public Opinion Quarterly, 60(2), 275-304.
- Durrant, G. B., Groves, R. M., Staetsky, L., & Steele, F. (2010). Auswirkungen von Interviewereinstellungen und -verhalten auf die Verweigerung bei Haushaltsbefragungen. Public Opinion Quarterly, 74(1), 1-36.