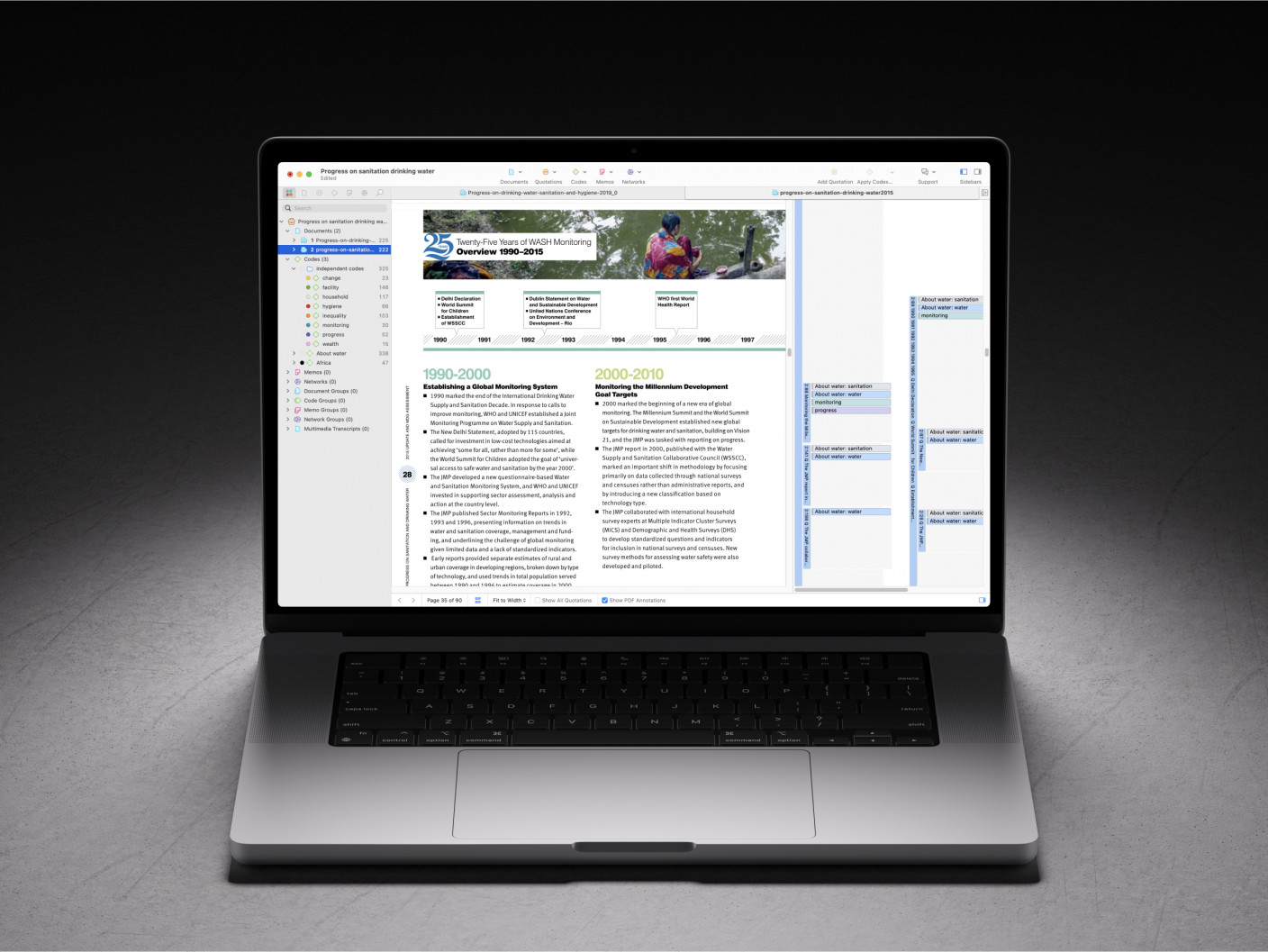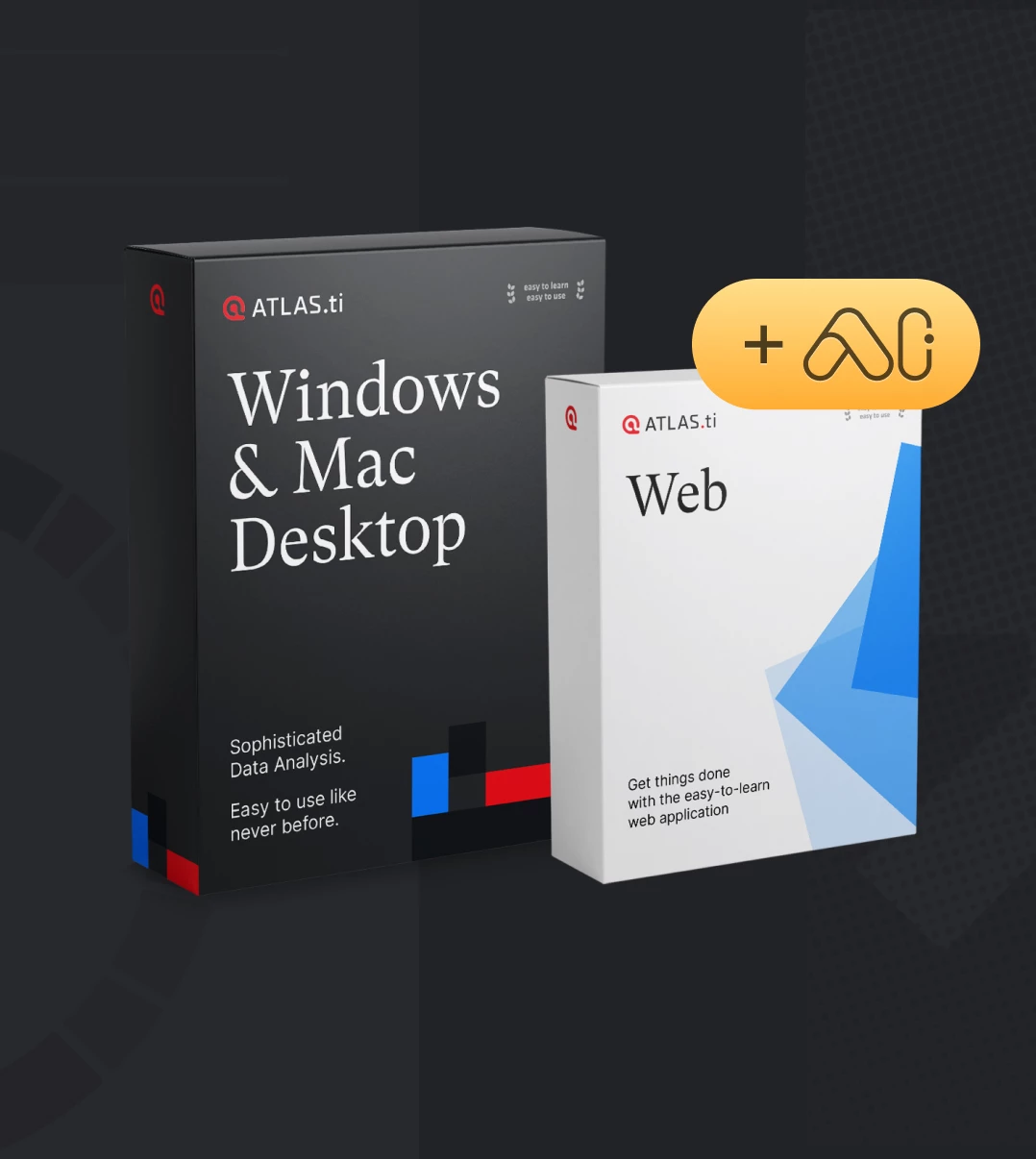Der Leitfaden zur Interviewanalyse
- Was ist eine Interviewanalyse?
- Vorteile von Interviews in der Forschung
- Nachteile von Interviews in der Forschung
- Ethische Überlegungen bei Interviews
- Vorbereitung eines Forschungsinterviews
- Rekrutierung und Stichprobenauswahl für Forschungsinterviews
- Interview Design
- Wie man Interviewfragen formuliert
- Vertrauensverhältnis in Interviews
- Soziale Erwünschtheit
- Interviewer-Effekt
- Arten von Forschungsinterviews
- Persönliche Interviewforschung
- Fokusgruppen-Interviews
- E-Mail-Interviews
- Telefoninterviews
- Stimulierte Erinnerungsinterviews
- Interviews vs. Umfragen
- Interviews vs. Fragebögen
- Interviews und Verhöre
- Wie transkribiert man Interviews?
- Verbatim Transkription
- Saubere Interviewtranskriptionen
- Manuelle Transkription von Interviews
- Automatisierte Transkription von Interviews
- Wie kommentiert man Forschungsinterviews?
- Formatierung und Anonymisierung von Interviews
- Interviews analysieren
- Kodierung von Interviews
- Berichterstattung und Präsentation der Interviewergebnisse
- Wie man den „Leitfaden zur Interviewanalyse“ zitiert
Nachteile von Interviews in der Forschung
Interviews sind eine gängige Methode zur Datenerhebung in der qualitativen Forschung, und sie werden dafür gefeiert, dass sie reichhaltige, nuancierte Erkenntnisse liefern. Unter der Oberfläche verbergen sich jedoch potenziell kritische Fehler, die die Informationen verfälschen könnten. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Nachteilen, die mit dem Interviewprozess in der qualitativen Forschung verbunden sind, insbesondere bei der Durchführung von persönlichen Interviews, sei es durch strukturierte Interviews, unstrukturierte Interviews oder andere Interviewformate.

Einführung
Es ist unbestritten, dass Interviews die dichtesten und tiefsten Informationen vermitteln, wenn es um die Datenerhebung geht. Andere Datenerhebungsmethoden wie Umfragen oder Fokusgruppen liefern zwar wertvolle Einblicke und ein breiteres Netz an Informationen, aber sie bieten nicht das tiefere Verständnis als Interviews.
Dennoch ist keine Methode perfekt und einige Nachteile können sich durchsetzen und die Qualität der gesammelten Informationen verringern. Dies kann von einer schlechten Fragestellung ausgehen, z. B. wenn Fragen gestellt werden, die keinen Einblick in das Forschungsprojekt geben, bis hin zu psychologischen Effekten, bei denen der Interviewer die Antworten der Teilnehmer unbewusst manipuliert.
Interviews sind eine weit verbreitete Methode der qualitativen Forschung, da sie ein tieferes Verständnis der Erfahrungen der Teilnehmer ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse liefern, die mit anderen Datenerhebungsmethoden, wie Umfragen oder quantitativen Methoden, möglicherweise nicht erfasst werden. Interviews liefern zwar eine Fülle von qualitativen Daten, haben aber auch eine Reihe von Nachteilen, mit denen qualitative Forscher vorsichtig umgehen müssen.
Nachteile der Befragung gegenüber anderen Datenerhebungsmethoden
Zeitaufwendig
Einer der größten Nachteile von Interviews ist, dass sie sehr zeitaufwändig sind. Der Interviewprozess umfasst mehrere Phasen, die jeweils viel Zeit in Anspruch nehmen. Qualitative Forscher müssen die Interviews sorgfältig planen und konzipieren und sicherstellen, dass die Interviewfragen gut formuliert sind, um sinnvolle Antworten zu erhalten. Die Durchführung qualitativer Forschung erfordert häufig die Planung von persönlichen oder Online-Interviews, was eine logistische Herausforderung darstellen kann, insbesondere wenn die Teilnehmer über verschiedene Standorte verteilt sind oder nur begrenzt verfügbar sind.
Bei der Befragung selbst, ob es sich nun um ein Einzelinterview, ein Panel-Interview oder sogar ein Telefoninterview handelt, muss der Prozess sorgfältig bis ins Detail geplant werden. Die Forscher müssen sich die Zeit nehmen, eine Beziehung aufzubauen, Folgefragen zu stellen und um Klärung zu bitten, um die Antworten der Teilnehmer vollständig zu verstehen. Nach dem Interview sind die Transkription und Datenanalyse Phasen ebenso zeitintensiv. Dieser ressourcenintensive Charakter von Interviews kann die Anzahl der Interviews begrenzen, die ein Forschungsteam durchführen kann, was sich möglicherweise auf die Breite der gesammelten Daten und den Gesamtumfang des Forschungsprojekts auswirkt.
Eingeschränkte Anonymität
Interviews, insbesondere persönliche Gespräch, verlangen von den Teilnehmern oft, dass sie persönliche Erfahrungen und Meinungen in einer Umgebung mitteilen, in der die Anonymität eingeschränkt ist. Im Gegensatz zu anderen Datenerhebungsmethoden, wie z. B. Umfragen oder Online-Fragebögen, bieten Interviews nicht dasselbe Maß an Anonymität, was sich auf die Bereitschaft der Teilnehmer auswirken kann, offen zu sprechen. Dies gilt insbesondere für Forschungsprojekte, die sensible Themen beinhalten oder von den Teilnehmern verlangen, persönliche oder potenziell stigmatisierende Informationen preiszugeben.
Der Mangel an Anonymität kann zu einer sozialen Erwünschtheit führen, bei dem die Teilnehmer ihre Antworten so verändern, dass sie dem entsprechen, was sie als sozial akzeptabel empfinden oder um eine Beurteilung zu vermeiden. Diese Einschränkung kann dazu führen, dass die Daten weniger die wahren Gedanken und Gefühle der Teilnehmer widerspiegeln, was die Qualität der erhobenen qualitativen Daten beeinträchtigt. Qualitative Forscher müssen die informierte Zustimmung und die Vertraulichkeit betonen, um ehrliche und offene Antworten zu fördern, obwohl dies die Auswirkungen der begrenzten Anonymität nicht ausschließt.
Ressourcenintensiv
Die Durchführung von Interviews erfordert erhebliche Ressourcen, darunter Zeit, Geld und qualifiziertes Personal. Diese ressourcenintensive Natur ist ein großer Nachteil, insbesondere für kleinere Forschungsteams oder Projekte mit begrenzten Budgets. Persönliche Befragungen können zum Beispiel Reisekosten, die Buchung von Veranstaltungsorten und die Anschaffung von Aufnahmegeräten erfordern, was die Gesamtkosten der Untersuchung erhöht. Auch Online-Befragungen sind zwar potenziell weniger kostspielig, erfordern aber eine zuverlässige Technologie und einen Internetzugang sowie die Zeit und den Aufwand, die für die Planung und Durchführung der Befragung erforderlich sind.
Der Ressourcenbedarf geht über das eigentliche Interview hinaus und erstreckt sich auch auf die Phase der Datenanalyse. Transkription von Interviews ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess, der oft zusätzliche Ressourcen wie Transkriptionssoftware oder professionelle Transkriptionisten erfordert. Darüber hinaus erfordert die Interviewanalyse, insbesondere bei komplexen Forschungsprojekten, hochentwickelte Software und geschulte Analysten, was die Kosten weiter in die Höhe treibt.

Potenzial für ungenaue Rückrufe
Interviews beruhen häufig auf der Fähigkeit der Teilnehmer, sich an frühere Erfahrungen, Meinungen oder Ereignisse zu erinnern. Das menschliche Gedächtnis ist jedoch fehlerhaft, und die Teilnehmer können während des Interviews ungenaue oder unvollständige Angaben machen. Die Teilnehmer können unbeabsichtigt Details auslassen, Ereignisse je nach aktuellem Verständnis anders rekonstruieren oder sogar mehrere Erfahrungen zu einer einzigen Erzählung zusammenfassen.
In manchen Forschungskontexten ist dieses Problem besonders problematisch, z. B. in retrospektiven Studien, in denen eine genaue Erinnerung für das Verständnis der untersuchten Phänomene entscheidend ist. Qualitative Forscher können dieses Risiko mindern, indem sie Techniken wie die Triangulation anwenden, bei der Informationen aus Interviews mit anderen Datenquellen abgeglichen werden, oder indem sie Gedächtnisstützen wie Zeitleisten verwenden, die den Teilnehmern helfen, sich genauer an Ereignisse zu erinnern. In der qualitativen Forschung entstehen die Daten bei den Interviews im Moment und spiegeln die aktuelle Perspektive und Stimme des Teilnehmers wider. Diese können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern.
Kulturelle und sprachliche Barrieren
In der kulturübergreifenden Forschung können Interviews aufgrund von Sprachunterschieden und kulturellen Nuancen eine Herausforderung darstellen. Diese Barrieren können zu Missverständnissen, Fehlinterpretationen oder sogar Beleidigungen führen, was die Qualität der erhobenen Daten beeinträchtigen kann. So können beispielsweise bestimmte Fragen oder Themen in verschiedenen kulturellen Kontexten unterschiedlich aufgefasst werden, was zu Antworten führt, die eher von kulturellen Normen als von den Gedanken oder Erfahrungen der Teilnehmer beeinflusst sind.
Sprachbarrieren stellen in der qualitativen Forschung eine besondere Herausforderung dar, da der Reichtum der Daten oft von einem nuancierten Ausdruck und einer detaillierten Beschreibung abhängt. Wenn die Teilnehmer die Sprache des Interviews nicht fließend beherrschen oder wenn Übersetzungen erforderlich sind, besteht die Gefahr, dass die ursprüngliche Bedeutung der Antworten verloren geht oder verändert wird. Qualitative Forscher müssen für diese Probleme sensibel sein und die Einbeziehung zweisprachiger Interviewer oder kultureller Vermittler in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass die erhobenen Daten so genau und repräsentativ wie möglich sind.
Ethische Erwägungen und informierte Zustimmung
Die Durchführung von Interviews, insbesondere zu sensiblen Themen, wirft wichtige ethische Fragen auf. Forscher müssen von den Teilnehmern eine informierte Zustimmung einholen, um sicherzustellen, dass sie den Zweck der Forschung, die Verwendung ihrer Daten und ihr Recht, jederzeit aus der Studie auszusteigen, vollständig verstehen. Der Prozess der Einholung einer informierten Zustimmung kann jedoch komplex sein, insbesondere in Fällen, in denen Machtdynamik im Spiel ist, wie z. B. bei Interviews mit gefährdeten Bevölkerungsgruppen oder in hierarchischen Organisationen.
Darüber hinaus kann die persönliche Interaktion, die mit Interviews einhergeht, ethische Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der Vertraulichkeit aufwerfen. Die Teilnehmer können während eines Interviews sensible Informationen preisgeben, die sie später bereuen oder die bei Offenlegung negative Folgen haben könnten. Qualitative Forscher müssen mit diesen ethischen Herausforderungen sorgfältig umgehen und die Notwendigkeit, wertvolle Erkenntnisse zu sammeln, mit der Verantwortung, die Rechte und das Wohlergehen der Teilnehmer zu schützen, abwägen.
Nachteile der verschiedenen Arten von Interviews
Bei der Analyse der Nachteile von Interviews in verschiedenen Formaten wie Fokusgruppen, Telefoninterviews, E-Mails und Face-to-Face-Interviews müssen sowohl logistische als auch methodische Herausforderungen berücksichtigt werden.
Fokusgruppen
In Fokusgruppen besteht ein großer Nachteil darin, dass dominante Teilnehmer das Gespräch verzerren können. Einige Personen sprechen von Natur aus mehr als andere, und ihre Meinungen können ruhigere Mitglieder in den Hintergrund drängen. Diese Dominanz kann die Gruppendynamik verzerren und unterschiedliche Perspektiven unterdrücken. Außerdem neigen Fokusgruppen zu Gruppendenken, bei dem die Teilnehmer den Druck verspüren, sich der Mehrheitsmeinung anzupassen, anstatt ihre wahren Gedanken zu äußern. Diese soziale Konformität kann die Authentizität der gesammelten Daten einschränken.
Der Erfolg von Fokusgruppen hängt in hohem Maße von der Fähigkeit des Moderators ab, das Gespräch auszubalancieren und alle Teilnehmer gleichermaßen einzubeziehen, was eine Herausforderung darstellen kann. Eine schlechte Moderation kann dazu führen, dass sich einige Teilnehmer ausgeschlossen fühlen oder weniger bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Ein weiterer Nachteil ist die logistische Schwierigkeit, Sitzungen so zu planen, dass sie für mehrere Personen geeignet sind. Eine gemeinsame Zeit für alle zu finden, kann den Prozess verzögern und die Beteiligung verringern. Schließlich schränken Fokusgruppen oft die Tiefe der Antworten ein, weil sich die Teilnehmer die Zeit teilen müssen, was eine umfassendere Erkundung der individuellen Perspektiven verhindert.
Face-to-Face-Interviews
Face-to-Face-Interviews liefern die reichhaltigsten Daten in Bezug auf die Tiefe und den persönlichen Bezug, aber sie sind nicht ohne Nachteil. Ein wesentlicher Nachteil ist der hohe Zeitaufwand, den diese Interviews mit sich bringen. Die Koordinierung von Terminen, die Vereinbarung von Orten und die Durchführung von persönlichen Treffen kann sowohl für den Forscher als auch für die Teilnehmer einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten. Dieser Prozess kann besonders schwierig sein, wenn Reisen erforderlich sind. Eine weitere Einschränkung ist die mögliche Verzerrung durch soziale Erwünschtheit. Wenn die Teilnehmer direkt vor einem Interviewer sitzen, fühlen sie sich möglicherweise unter Druck gesetzt, sozial akzeptable Antworten zu geben, anstatt ihre wahren Gedanken zu äußern. Dies kann die Daten verfälschen und ihre Authentizität beeinträchtigen. Persönliche Befragungen sind in der Regel auch teurer.
Die Kosten für die Reise, die Miete des Veranstaltungsortes und die Vergütung der Teilnehmer können sich summieren, so dass diese Methode für größere Studien weniger geeignet ist. Darüber hinaus kann der Interviewer die Antworten der Teilnehmer ungewollt beeinflussen. Nonverbale Hinweise, Gesichtsausdrücke oder sogar der Tonfall des Interviewers können die Antworten der Teilnehmer beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Daten auswirkt. Schließlich können logistische Herausforderungen, wie die Suche nach einem bequemen, neutralen und privaten Raum für sensible Interviews, die Qualität der Antworten beeinträchtigen, insbesondere wenn sich die Teilnehmer unwohl fühlen oder in Eile sind.
Telefoninterviews
Telefoninterviews sind zwar praktisch, bringen aber auch einige besondere Herausforderungen mit sich. Eine der größten Einschränkungen ist das Fehlen von visuellen Hinweisen. Ohne Körpersprache oder Gesichtsausdrücke ist es für die Interviewer schwieriger, Emotionen, Unbehagen oder Zögern zu erkennen, was wertvolle Hinweise liefern kann. Die fehlende visuelle Verbindung macht es auch schwieriger, eine Beziehung zu den Teilnehmern aufzubauen, was zu kürzeren, weniger fesselnden Gesprächen führen kann. Dieses Medium kann sich unpersönlich anfühlen, und Ablenkungen in der Umgebung des Teilnehmers können seine Konzentration und sein Engagement weiter verringern. Technische Probleme, wie z. B. eine schlechte Gesprächsqualität oder unterbrochene Verbindungen, können den Gesprächsfluss unterbrechen und zu unvollständigen oder missverstandenen Antworten führen. Telefoninterviews sind oft kürzer als persönliche Gespräche, da die Teilnehmer dazu neigen, kürzere Antworten zu geben, ohne sich im gleichen Maße zu engagieren. Dies kann den Reichtum der gesammelten Daten einschränken. Die Teilnehmer zögern möglicherweise, am Telefon über sensible Themen zu sprechen, was zu weniger offenen Antworten führt.

Psychologische Auswirkungen in Interviews
Während eines Interviews können verschiedene psychologische Effekte auftreten, die sowohl das Verhalten und die Antworten des Interviewers als auch des Teilnehmers beeinflussen können. Im Folgenden sind einige wichtige psychologische Effekte aufgeführt, die Sie berücksichtigen und über die Sie nachdenken sollten:
Verzerrung durch soziale Erwünschtheit
Verzerrung durch soziale Erwünschtheit tritt auf, wenn die Teilnehmer ihre Antworten so anpassen, dass sie dem entsprechen, was sie in den Augen des Interviewers für sozial akzeptabel oder günstig halten. Dies ist besonders häufig bei Interviews der Fall, in denen sensible oder kontroverse Themen diskutiert werden. Die Teilnehmer könnten Verhaltensweisen oder Meinungen, die sie als unerwünscht empfinden, herunterspielen und diejenigen betonen, die sie für akzeptabler halten. Dies kann zu ungenauen oder verzerrten Daten führen, da die wahren Gefühle oder Verhaltensweisen des Teilnehmers nicht vollständig offengelegt werden.
Der Hawthorne-Effekt
Ein besonderer Nachteil von Interviews ist der so genannte "Hawthorne-Effekt". Er ähnelt der Verzerrung durch soziale Erwünschtheit, da er auftritt, wenn Teilnehmer ihr Verhalten ändern, nur weil sie wissen, dass sie beobachtet oder befragt werden. Dieser Effekt, der nach einer Reihe von Studien in der Fabrik Hawthorne Works in den 1920er Jahren benannt wurde (Levitt & List, 2011), kann dazu führen, dass die Teilnehmer Antworten geben, von denen sie glauben, dass der Interviewer sie hören möchte, oder dass sie sich während des Interviews anders verhalten, als sie es im Alltag tun würden. Im Grunde genommen kann allein schon der Akt der Befragung die Art und Weise verändern, wie Menschen antworten, was es schwierig macht, völlig authentische Daten zu erhalten.
Der Hawthorne-Effekt ist nach einer Reihe von Studien benannt, die in den 1920er bis 1930er Jahren in der Fabrik Western Electric Hawthorne Works in Chicago durchgeführt wurden. Die Forscher untersuchten, wie sich unterschiedliche Arbeitsbedingungen, z. B. die Beleuchtungsstärke, auf die Produktivität der Arbeiter auswirkten. Sie fanden heraus, dass sich die Produktivität bei jeder Änderung verbesserte, selbst wenn sich die Bedingungen tatsächlich verschlechterten, einfach weil die Arbeiter wussten, dass sie beobachtet wurden. Dieser Effekt zeigte, dass die bloße Anwesenheit von Forschern und die Aufmerksamkeit für die Tätigkeiten der Arbeitnehmer das Verhalten beeinflussen und unabhängig von den vorgenommenen Änderungen zu einer höheren Produktivität führen konnte.
Der Telefon-Effekt
Der "Telefoneffekt" tritt auf, wenn das Fehlen eines visuellen Kontexts zu Missverständnissen, Fehlinterpretationen oder zum Verlust subtiler emotionaler Hinweise führen kann. Im Gegensatz zu persönlichen Interviews, wo Körpersprache, Mimik und andere nonverbale Hinweise eine wichtige Rolle in der Kommunikation spielen, verlassen sich telefonische oder virtuelle Interviews stark auf die Stimme allein. Infolgedessen kann die Fülle der Daten beeinträchtigt werden, so dass es für den Interviewer schwieriger ist, die Emotionen oder Absichten des Teilnehmers vollständig zu erfassen.
Ein berühmtes Beispiel für die Auswirkungen des "Telefoneffekts" auf die Datenerhebung ist der Hite-Bericht über weibliche Sexualität, der in den 1970er Jahren von Shere Hite durchgeführt wurde. Obwohl der Bericht bahnbrechende Ergebnisse lieferte, sammelte Hite einen Großteil ihrer Daten durch schriftliche Fragebögen und nicht durch persönliche Interviews (Shere, 1976). Dieser Rückgriff auf nicht-persönliche Kommunikationsmethoden, ähnlich dem "Telefon-Effekt", könnte zu einigen Fehlinterpretationen oder einer mangelnden Tiefe der Antworten geführt haben, da die Teilnehmer ihre Gedanken oder Gefühle nicht in Echtzeit mit einem Interviewer klären konnten. Kritiker argumentierten, dass der Mangel an direkter Interaktion die Authentizität und Reichhaltigkeit der Daten beeinträchtigt haben könnte.
Verzerrung der Erinnerung
Erinnerungsverzerrungen treten auf, wenn die Teilnehmer Schwierigkeiten haben, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern, was zu unvollständigen oder veränderten Erinnerungen führt. Diese Verzerrung kann bei Interviews besonders problematisch sein, da die Qualität der qualitativen Daten oft von der Fähigkeit der Teilnehmer abhängt, ihre Erfahrungen detailliert zu schildern. Es kann vorkommen, dass Teilnehmer unbeabsichtigt Details auslassen, mehrere Ereignisse vermischen oder Erinnerungen auf der Grundlage ihrer Überzeugungen oder Gefühle rekonstruieren. Dies kann zu Daten führen, die nicht völlig zuverlässig oder repräsentativ sind.
Paradoxon der Selbstauskunft
Das "Paradox der Selbstoffenbarung“. Während Interviews sind die Teilnehmer möglicherweise zunächst zurückhaltend, werden aber nach und nach offener, wenn sie eine Beziehung zum Interviewer aufbauen. Interessanterweise kann dies manchmal dazu führen, dass sie mehr persönliche oder sensible Informationen preisgeben als ursprünglich beabsichtigt. Nach dem Interview kann es jedoch vorkommen, dass die Teilnehmer die Offenlegung bereuen, weil sie sich unwohl fühlen oder sich Sorgen machen, zu viel erzählt zu haben. Dieses Phänomen kann sich auf die Gefühle der Teilnehmer gegenüber ihrer Teilnahme an der Studie auswirken und ihre Antworten beeinflussen, wenn Folgebefragungen durchgeführt werden.
Das Paradoxon der Selbstoffenbarung wurde in Philip Zimbardos Stanford Prison Experiment (Zimbardo, 1973) deutlich, bei dem die Teilnehmer nach und nach mehr von sich preisgaben und Verhaltensweisen an den Tag legten, die sie nicht erwartet hatten. Als die simulierte Gefängnisumgebung intensiver wurde, begannen einige Teilnehmer (die die Rolle der Wärter spielten), zunehmend aggressives Verhalten an den Tag zu legen, während andere (die die Rolle der Gefangenen spielten) unterwürfiger wurden. Viele der Teilnehmer äußerten später ihr Bedauern oder ihr Unbehagen darüber, wie sehr sie sich auf ihre Rollen eingelassen und welche persönlichen Aspekte sie während des Experiments preisgegeben hatten, was das Paradoxon verdeutlicht, dass die anfängliche Offenheit im Laufe der Studie zu einer unangenehmen Selbstentblößung führte.
Schlussfolgerung
Interviews sind eine leistungsstarke Methode der qualitativen Forschung, die tiefe Einblicke in menschliche Erfahrungen und Verhaltensweisen bieten kann, aber auch Nachteile mit sich bringt. Der Interviewprozess ist zeit- und ressourcenaufwändig. Darüber hinaus erschweren die fehlende Anonymität und die Herausforderungen durch interkulturelle und sprachliche Barrieren den Einsatz von Interviews in der qualitativen Forschung zusätzlich.
Trotz dieser Herausforderungen bleiben Interviews ein wertvolles Instrument im Arsenal des qualitativen Forschers, insbesondere wenn die Forschungsfrage ein tieferes Verständnis komplexer Phänomene erfordert. Qualitative Forscher müssen sich jedoch der Nachteile von Interviews bewusst sein und Maßnahmen ergreifen, um diese Herausforderungen so weit wie möglich abzumildern und sicherzustellen, dass die erhobenen Daten sowohl von hoher Qualität als auch ethisch einwandfrei sind. Durch sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren können Forschungsteams Interviews durchführen, die wertvolle Erkenntnisse liefern und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken und Einschränkungen minimieren.
Referenzen
- Hite, Shere. (1976). Der Hite-Bericht: eine landesweite Studie über weibliche Sexualität. New York: Macmillan,
- Levitt, S. D., & List, J. A. (2011). Gab es wirklich einen Hawthorne-Effekt in der Hawthorne-Fabrik? An analysis of the original illumination experiments. American Economic Journal: Applied Economics, 3(1), 224-238. https://doi.org/10.1257/app.3.1.224
- Zimbardo, P. G. (1973). Zur Ethik der Intervention in der humanpsychologischen Forschung: With special reference to the Stanford prison experiment. Cognition, 2(2), 243-256.