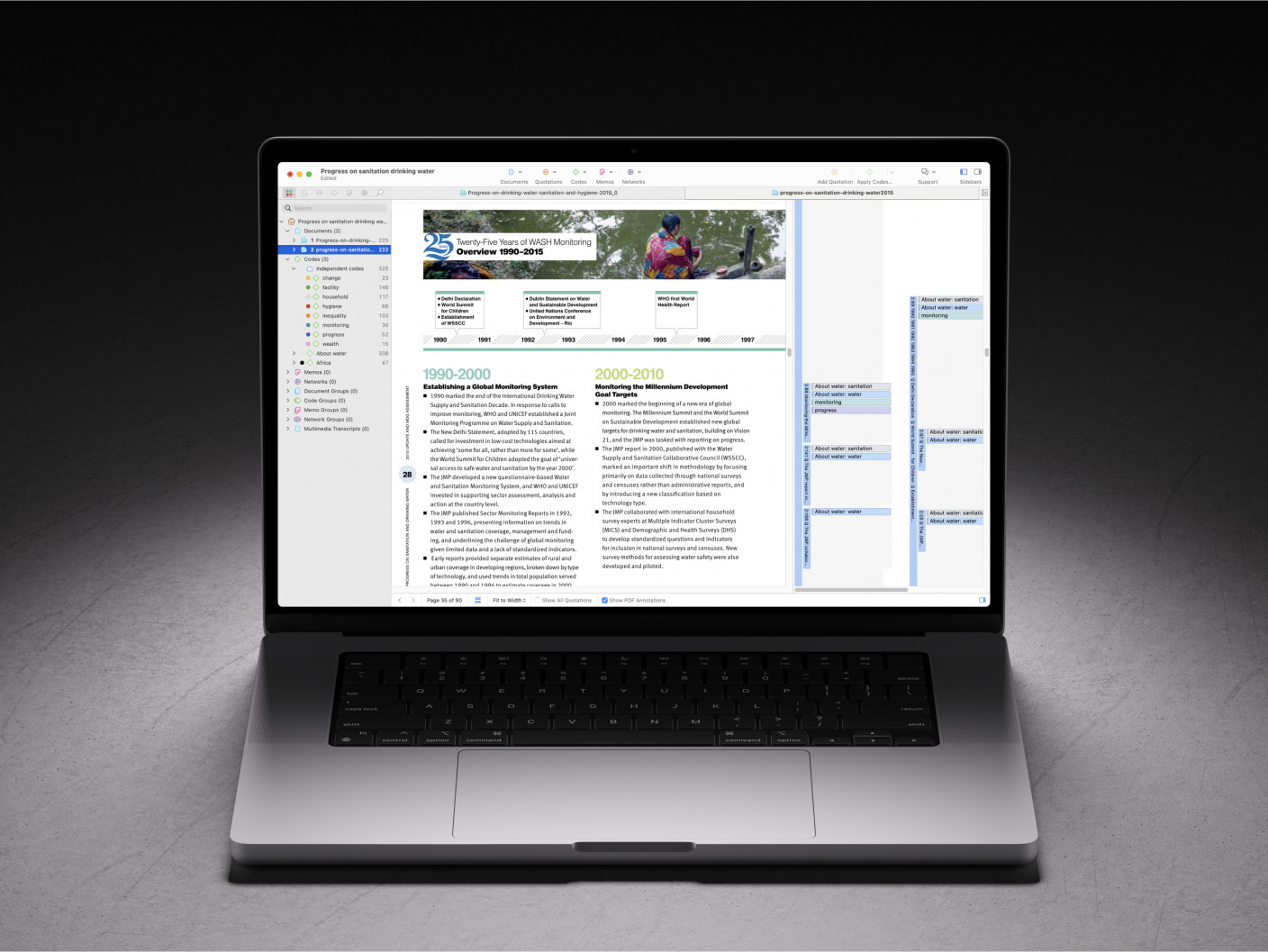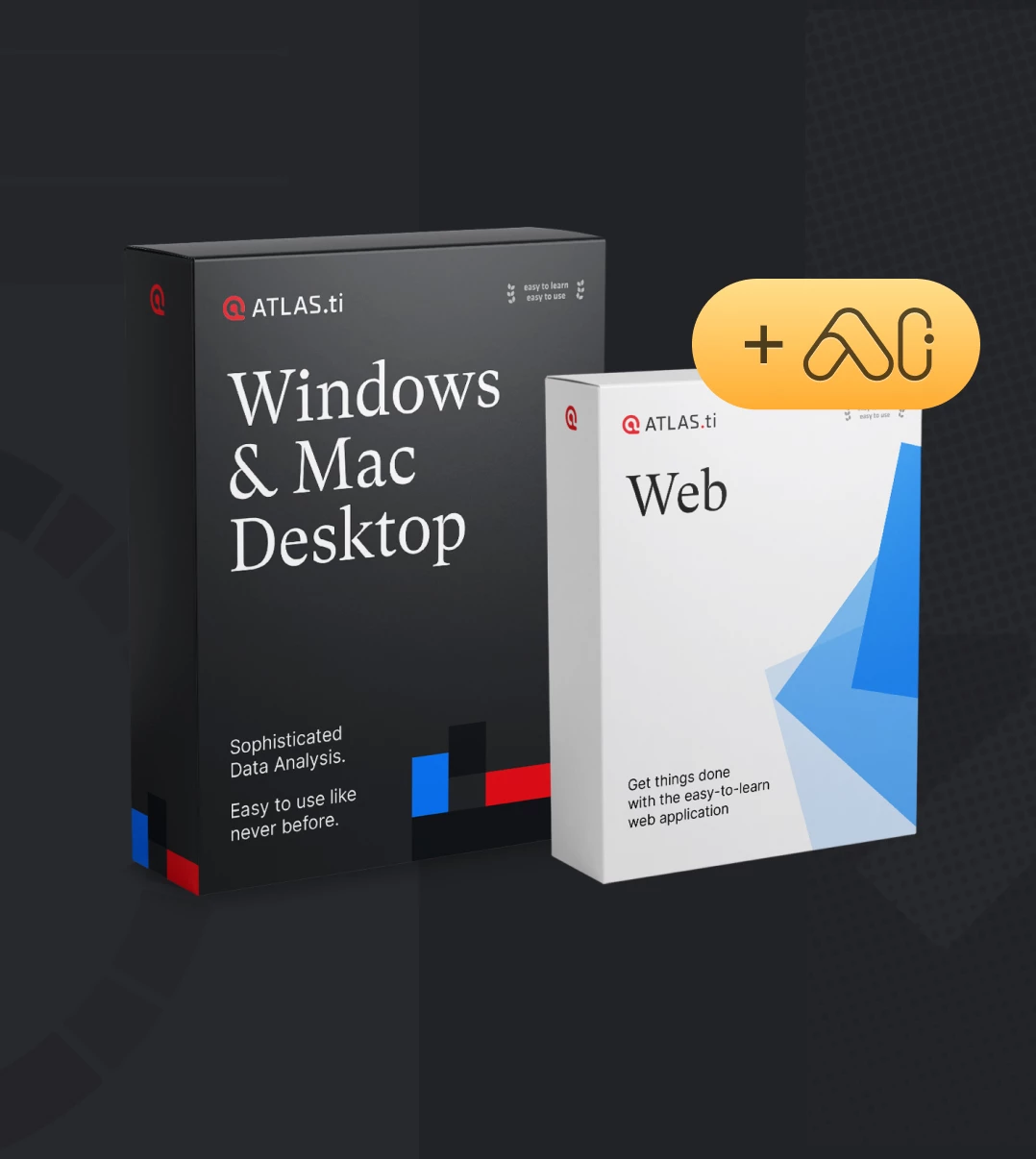Leitfaden für die Forschung mit gemischten Methoden
- Was ist Mixed-Methods-Forschung?
- Vorteile der Mixed-Methods-Forschung
- Herausforderungen in der Mixed-Methods-Forschung
- Häufige Fehler in der Mixed-Methods-Forschung
- Forschungsparadigmen mit gemischten Methoden
- Validität und Reliabilität in der Mixed-Methods-Forschung
- Ethische Überlegungen bei der Forschung mit gemischten Methoden
- Gemischte Methoden vs. Mehrfachmethodenforschung
- Forschungsdesigns mit gemischten Methoden
- Wie man das richtige Mixed-Methods-Design auswählt
- Konvergentes paralleles Design
- Erklärendes sequentielles Design
- Exploratives sequentielles Design
- Eingebettetes Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Transformatives Design mit gemischten Methoden
- Mehrphasiges Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Wie man Forschung mit gemischten Methoden durchführt
- Stichprobenstrategien in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenerhebung in der Mixed-Methods-Forschung
- Triangulation in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung
- Wie lassen sich quantitative und qualitative Daten integrieren?
- Wie interpretiert man Forschungsergebnisse aus gemischten Methoden?
- Software-Tools für die Datenanalyse mit gemischten Methoden
- Wie man einen Forschungsantrag für gemischte Methoden schreibt
- Wie schreibt man eine Forschungsarbeit mit gemischten Methoden?
- Ergebnisberichterstattung in der Mixed-Methods-Forschung
- Beispiele für Mixed-Methods-Forschung
- Wie zitiert man „Leitfaden zur Forschung mit gemischten Methoden“?
Eingebettetes Mixed Methods Forschungsdesign
Das eingebettete Forschungsdesign in der Mixed-Methods-Forschung bedeutet, dass der Forscher quantitative und qualitative Daten innerhalb eines traditionellen Forschungsdesigns mit gemischten Methoden sammelt und analysiert. Die zweite Datenerhebung kann an jedem beliebigen Punkt der primären Datenerhebung stattfinden, je nach dem gewählten Design. In diesem Artikel gehen wir auf den Zweck, die Auswahl und die Durchführung eines eingebetteten Forschungsdesigns ein.
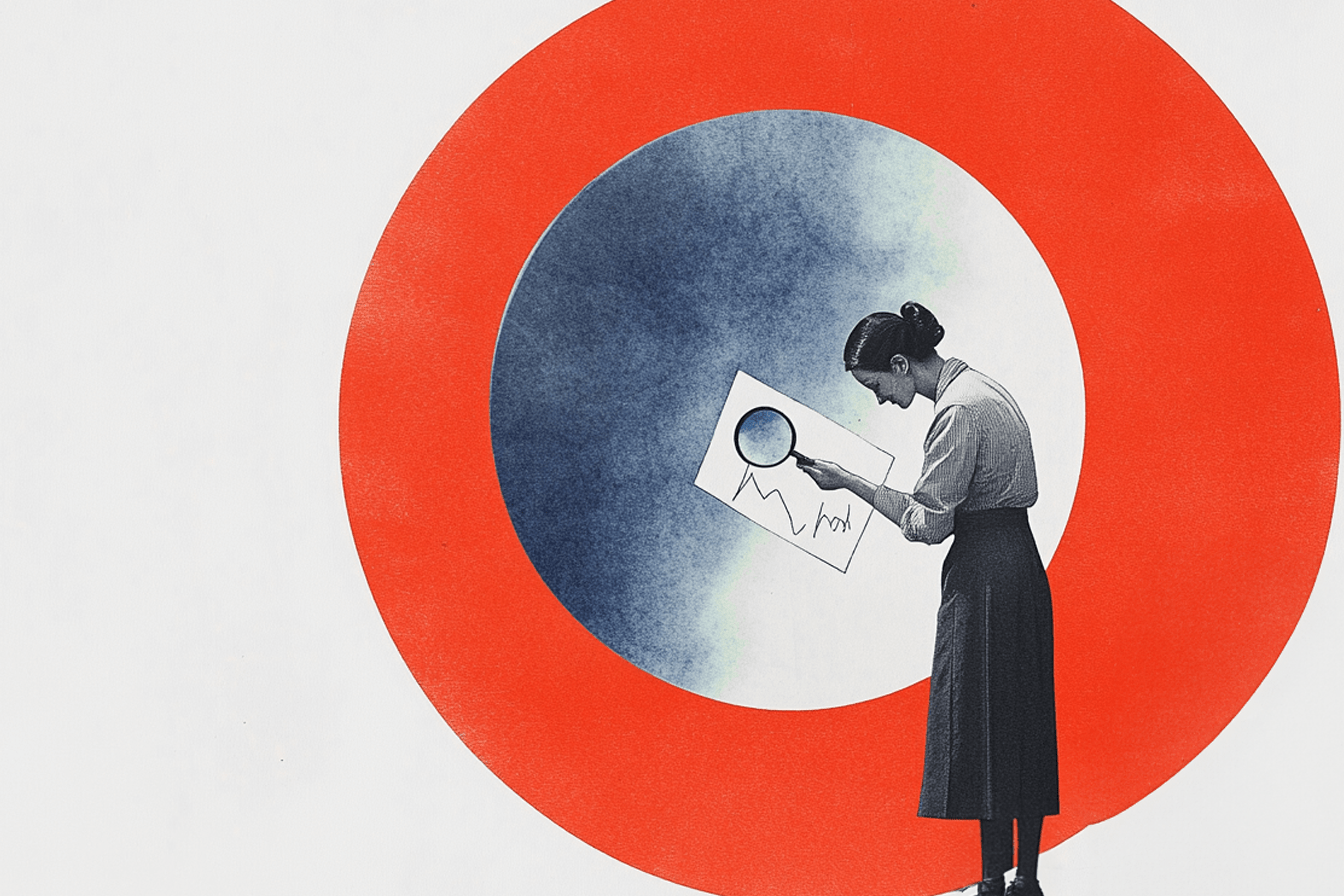
Einführung
Das eingebettete Mixed-Methods-Forschungsdesign integriert qualitative Daten in vorwiegend quantitative Studien (oder umgekehrt), um sekundäre Forschungsfragen zu beantworten oder tiefere Einblicke in die Primärstudie zu ermöglichen. Greene, Caracelli und Graham (1989) sowie Creswell und Plano Clark spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des eingebetteten Designs. Sie betonten die Einbettung verschiedener Datentypen, um die Rekrutierung zu verbessern, Interventionsprozesse zu verstehen und die Erfahrungen der Teilnehmer zu untersuchen.
Aufgrund seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, spezifische Forschungsbedürfnisse zu erfüllen, wurde das Embedded Design von vielen Forschern als eines der wichtigsten Mixed-Methods-Frameworks übernommen. Dieses Design hat sich insbesondere in Bereichen wie den Gesundheits- und Sozialwissenschaften durchgesetzt.
Das eingebettete Design in der Mixed-Methods-Forschung integriert qualitative und quantitative Daten innerhalb eines primären Forschungsrahmens und ermöglicht es den Forschern, zusätzliche Forschungsfragen zu beantworten. Bei diesem Ansatz wird ein sekundärer Datensatz - qualitative Daten innerhalb eines quantitativen Rahmens oder umgekehrt - in jeder Phase des Forschungsprozesses eingebettet, sei es vor, während oder nach der Erhebung und Analyse der Primärdaten. In einigen Fällen spielen die sekundären Daten eine unterstützende Rolle, wie z. B. die Einbindung qualitativer Erkenntnisse in ein quantitatives Experiment, um bestimmte Aspekte wie Interventionsprozesse oder Teilnehmerreaktionen zu untersuchen.
Das eingebettete Design ist besonders nützlich, wenn ein einzelner Datensatz nicht ausreicht, um alle Forschungsfragen zu beantworten, da es den Forschern ermöglicht, verschiedene Fragen zu beantworten, die unterschiedliche Datentypen erfordern. So können beispielsweise qualitative Daten in eine vorwiegend quantitative Studie eingebettet werden, um die Rekrutierungsstrategien zu verbessern oder die Reaktionen der Teilnehmer zu erklären. Die Ziele für die Integration des sekundären Datensatzes unterscheiden sich oft vom Hauptzweck der Studie, wie z. B. der Bewertung der Wirksamkeit einer Behandlung.
Dieses Design unterscheidet sich von konvergente Designs, bei dem qualitative und quantitative Methoden eingesetzt werden, um eine einheitliche Forschungsfrage zu beantworten. Stattdessen ergänzt der eingebettete Ansatz die primäre Ausrichtung der Studie, so dass er sich für Forscher mit begrenzten Ressourcen oder weniger Erfahrung mit der Sekundärmethode eignet. Die Forscher müssen auch sicherstellen, dass das gewählte Design mit den Hauptzielen ihrer Studie übereinstimmt und Faktoren wie Fachwissen und Ressourcenzuweisung berücksichtigen.
Forscher entscheiden sich für dieses Forschungsdesign mit gemischten Methoden, wenn sie über das Fachwissen verfügen, um das Design rigoros umzusetzen, und sich damit wohlfühlen, dass die Studie von einer primären Orientierung geleitet wird. Es wird auch verwendet, wenn der Forscher keine Erfahrung mit der ergänzenden Methode hat und nicht über die Ressourcen verfügt, um beiden Arten von Daten die gleiche Priorität einzuräumen.
Der zusätzliche Datensatz ist sekundär und dient als Hauptmethode. Er ist kein gleichberechtigter Partner, sondern trägt vielmehr zu ergänzenden Erkenntnissen bei, z. B. zur Kontextualisierung von Ergebnissen in einer quantitativen Studie oder zur Erforschung bestimmter Elemente in einer qualitativen Studie.
Philosophische Annahmen im eingebetteten Forschungsdesign
Die philosophischen Annahmen, die dem eingebetteten Design in der Mixed-Methods-Forschung zugrunde liegen, basieren auf der paradigmatischen Grundlage des primären methodischen Ansatzes, der verwendet wird. Dieses Design zielt darauf ab, die Anwendung eines traditionellen quantitativen oder qualitativen Designs zu verbessern, indem es einen zusätzlichen Datensatz einbezieht, der den Hauptansatz unterstützt.
Das eingebettete Design arbeitet unter den philosophischen Annahmen des primären Ansatzes. Ein quantitatives Primärdesign (z. B. ein experimentelles oder ein Längsschnittdesign) entspricht in der Regel postpositivistischen Annahmen und konzentriert sich auf Objektivität, Messung und kausale Beziehungen. Andererseits spiegelt ein qualitatives Primärdesign (z. B. phänomenologisch oder ethnografisch) oft ein konstruktivistisches Paradigma wider, das subjektive Bedeutungen, soziale Kontexte und die Perspektiven der Teilnehmer betont.
Dieses Design erkennt an, dass die philosophischen Grundlagen qualitativer (konstruktivistischer) und quantitativer (postpositivistischer) Ansätze nicht von Natur aus unvereinbar sind, sondern strategisch kombiniert werden können. So können beispielsweise qualitative Daten die quantitativen Ergebnisse vertiefen oder umgekehrt, ohne die Kohärenz der primären Methode zu untergraben.
Das eingebettete Design spiegelt häufig einen pragmatischen Forschungsansatz wider, bei dem die Forschungsfragen Vorrang vor der strikten Befolgung eines einzigen Paradigmas haben. Die Forscher wählen den sekundären Datensatz auf der Grundlage seiner Fähigkeit aus, bestimmte Aspekte des Forschungsproblems zu behandeln, die mit der primären Methode allein nicht behandelt werden können.
Wie macht man ein eingebettetes Design?
Das eingebettete Design in der Mixed-Methods-Forschung beinhaltet die Erhebung sowohl quantitativer als auch qualitativer Daten, wobei eine Art als ergänzende Komponente zur Unterstützung der Primärdaten dient. Dieses Design kann entweder einen einphasigen oder einen zweiphasigen Ansatz verfolgen. Beim einphasigen Ansatz werden beide Datentypen gleichzeitig erhoben, aber einer spielt eine untergeordnete Rolle, während beim zweiphasigen Ansatz ein Datentyp vor oder nach dem anderen erhoben wird, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, z. B. um das Studiendesign zu informieren oder die Ergebnisse zu erklären. Zu den Hauptmerkmalen des eingebetteten Designs gehört die ergänzende Rolle der sekundären Daten, die in den primären Datenerhebung Prozess eingebettet sind, um das Verständnis zu verbessern, anstatt allein zu stehen. Außerdem befassen sich die quantitativen und qualitativen Daten mit unterschiedlichen Forschungsfragen innerhalb derselben Studie, und die ergänzenden Daten würden ihre Bedeutung verlieren, wenn sie nicht mit den Primärdaten verbunden wären.
- Die Festlegung einer klaren Forschungsfrage ist für jede Forschung mit gemischten Methoden unerlässlich. Die Forschungsfrage leitet Entscheidungen über Datenerhebung, Analyse und Interpretation. Eingebettete Designs ermöglichen jedoch Flexibilität, und die Forscher können ihren Ansatz anpassen, wenn die Datenerhebung fortschreitet und neue Erkenntnisse zutage treten. Es gibt zwar kein Patentrezept für das Design einer eingebetteten Studie, aber die folgenden Schritte bieten allgemeine Richtlinien für die Strukturierung des Forschungsprozess.
- Entscheiden Sie, welche Art von Daten als Primärdaten dienen sollen. Der erste Schritt in einem eingebetteten Design ist die Entscheidung, ob qualitative oder quantitative Daten die primäre Quelle der Evidenz sein werden. Diese Entscheidung hängt von der Forschungsfrage und den allgemeinen Zielen der Studie ab. Erfordert die Untersuchung eine eingehende, kontextbezogene Erforschung eines Phänomens, können qualitative Daten den Vorrang haben. Wenn die Studie hingegen darauf abzielt, Muster zu erkennen, Variablen zu messen oder Trends zu bewerten, können quantitative Daten als Hauptdatensatz dienen. Forscher sollten auch ihre erkenntnistheoretische Haltung berücksichtigen - ob sie zu post-positivistischen Annahmen tendieren, bei denen Messung und Objektivität im Vordergrund stehen, oder zu konstruktivistischen Perspektiven, bei denen Bedeutung und Interpretation im Vordergrund stehen.
- Überlegen Sie, wie die zweite Art von Daten die Hauptdaten ergänzen wird. Sobald die Art der Primärdaten feststeht, ist der nächste Schritt die Bestimmung, wie die Sekundärdaten diese ergänzen werden. Die Sekundärdaten sollten zusätzliche Erkenntnisse liefern, die die Hauptergebnisse verbessern oder verdeutlichen. In einer primär quantitativen Studie können qualitative Daten beispielsweise dazu beitragen, unerwartete Ergebnisse zu erklären oder numerische Trends in einen tieferen Zusammenhang zu stellen. In einer qualitativen Studie können quantitative Daten Themen unterstützen, die sich durch numerische Belege oder die Identifizierung von Mustern in einer größeren Stichprobe ergeben. Die Sekundärdaten sollten mit den Zielen der Studie übereinstimmen und das Gesamtverständnis des Forschungsproblems verbessern.
- Wählen Sie einen ein- oder zweiphasigen Ansatz für die Datenerhebung. Eingebettete Designs können entweder einen ein- oder zweiphasigen Ansatz verfolgen, je nachdem, wie die Daten erhoben werden. Bei einem einphasigen Ansatz erheben die Forscher gleichzeitig qualitative und quantitative Daten. Dies geschieht häufig im Rahmen eines einzigen Instruments, z. B. einer Umfrage, die sowohl geschlossene als auch offene Fragen enthält. Bei einem zweiphasigen Ansatz wird zunächst eine Art von Daten erhoben, und die zweite Art wird auf der Grundlage der ersten Ergebnisse gesammelt. Dieser sequenzielle Ansatz ist nützlich, wenn qualitative Erkenntnisse zur Verfeinerung eines quantitativen Instruments beitragen oder wenn erste statistische Muster zu qualitativen Folgebefragungen führen. Die Wahl zwischen diesen Ansätzen hängt von der Durchführbarkeit, dem Zeitplan und der Rolle der eingebetteten Daten bei der Beantwortung der Forschungsfrage ab.
- Datenerhebung und -auswertung. Die Datenerhebung sollte sich an der gewählten Struktur der Studie orientieren. In der Regel beginnen Forscher zunächst mit der Analyse der Primärdaten, da diese die Grundlage der Studie bilden. Sobald die Primärdaten analysiert sind, werden die Sekundärdaten in Bezug auf die Hauptergebnisse untersucht. Wenn der Hauptdatensatz beispielsweise aus Umfrageantworten besteht, können qualitative Interviewauszüge analysiert werden, um einen tieferen Einblick in bestimmte Trends zu erhalten. Handelt es sich bei den Primärdaten um qualitative Daten, können sekundäre quantitative Daten helfen, Muster zu erkennen, die thematische Interpretationen unterstützen oder verfeinern könnten. Während dieses gesamten Prozesses sollten die Forscher transparent machen, wie die Sekundärdaten den Hauptdatensatz informieren und mit ihm interagieren.
- Interpretation der Ergebnisse. Der letzte Schritt besteht in der Integration der Ergebnisse aus beiden Datenquellen, um eine umfassende Antwort auf die Forschungsfrage zu finden. Die Interpretation sollte über die bloße Darstellung von zwei Ergebnissätzen hinausgehen und sich darauf konzentrieren, wie die eingebetteten Daten die primären Ergebnisse verstärken oder in Frage stellen. Die Forscher sollten überlegen, ob die zusätzlichen Daten die Hauptschlussfolgerungen verstärken, verfeinern oder nuancieren. In dieser Phase werden auch die Auswirkungen des Mixed-Methods-Ansatzes erörtert, einschließlich der Frage, wie das eingebettete Design zu einem tieferen Verständnis des Forschungsproblems beigetragen hat.
Durch die Befolgung dieser Schritte können Forscher ein eingebettetes Design effektiv umsetzen, das einen strukturierten und dennoch flexiblen Ansatz für die Mixed-Methods-Forschung ermöglicht.
Gestaltungsvarianten
Nach Creswell und Plano Clark (2006) sind die beiden Hauptvarianten des eingebetteten Designs das experimentelle Modell und das Korrelationsmodell, die sich beide durch ihren Zweck und ihre Datenintegrationsstrategie unterscheiden. Das experimentelle Modell zielt darauf ab, Interventionsprozesse oder -ergebnisse zu verstehen, während das Korrelationsmodell darauf abzielt, Beziehungen zwischen Variablen zu erklären. Beide Modelle haben einen dominanten quantitativen Schwerpunkt, wobei qualitative Daten eine ergänzende, erklärende Rolle spielen.
Eingebettetes experimentelles Modell
Bei diesem Modell sind die qualitativen Daten in einen primär quantitativen Versuchsplan eingebettet, z. B. in ein Experiment oder Quasi-Experiment. Die quantitative Methode ist dominant, während die qualitative Komponente die quantitativen Daten unterstützt und bereichert. Sie kann in einer oder zwei Phasen durchgeführt werden. Bei einem einphasigen Ansatz werden während der Interventionsphase qualitative Daten erhoben, um neben der Messung der quantitativen Ergebnisse die Erfahrungen der Teilnehmer oder den Prozess der Intervention zu untersuchen. Bei einem zweiphasigen Ansatz werden die qualitativen Daten entweder vor oder nach der Intervention erhoben. Vor der Intervention dienen sie der Gestaltung der Intervention oder der Auswahl der Teilnehmer. Nach der Intervention erläutern sie die quantitativen Ergebnisse oder liefern weitere Erkenntnisse. Dieses Modell wird häufig verwendet, um den Prozess hinter einer Intervention zu verstehen, quantitative Ergebnisse zu erklären oder zu interpretieren und die Entwicklung von Messinstrumenten zu unterstützen.
Eingebettetes Korrelationsmodell
Das Hauptziel des eingebetteten Korrelationsmodells besteht darin, über numerische Beziehungen hinauszugehen und ein tieferes Verständnis der Faktoren zu erlangen, die diese Zusammenhänge beeinflussen. In der traditionellen Korrelationsforschung können die Ergebnisse auf eine signifikante Beziehung zwischen Variablen hinweisen, aber die Gründe für diese Assoziationen bleiben oft unklar. Durch die Einbeziehung qualitativer Daten können Forscher die Erfahrungen der Teilnehmer, ihre Motivationen oder situative Faktoren untersuchen, die zu diesen Zusammenhängen beitragen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich, wenn es um komplexe soziale, verhaltensbezogene oder psychologische Phänomene geht, bei denen numerische Trends allein die Nuancen menschlicher Interaktionen möglicherweise nicht vollständig erfassen. Die Datenerhebung in diesem Modell folgt einer vorwiegend quantitativen Struktur, wobei qualitative Daten eine unterstützende Rolle spielen. Die Forscher beginnen in der Regel mit quantitativen Methoden wie Umfragen oder groß angelegten Fragebögen, um Korrelationen zwischen Schlüsselvariablen zu ermitteln.
Stärken
Das eingebettete Design ist ideal, wenn ein Forscher einer Datenart (quantitativ oder qualitativ) den Vorrang geben und die andere als ergänzende Komponente verwenden möchte. Dies sind weitere Stärken des eingebetteten Forschungsdesigns:
- Ergänzende Daten: Das Hinzufügen zusätzlicher Daten verbessert das gesamte Forschungsdesign, indem es Lücken schließt oder zusätzlichen Kontext liefert, was zu einer umfassenderen und robusteren Studie führt.
- Kollaboratives Umfeld: Dieses Design funktioniert gut in kollaborativen Forschungsteams und ermöglicht es den Mitgliedern, sich auf spezifische Fragen zu konzentrieren, die ihren Fachkenntnissen und Interessen entsprechen.
- Gewinnung von Fördermitteln: Förderorganisationen, die mit gemischten Methoden weniger vertraut sind, könnten dieses Design attraktiv finden, da es sich in erster Linie auf einen traditionellen quantitativen oder qualitativen Rahmen stützt, was es leichter zugänglich macht.
Herausforderungen
Das eingebettete Forschungsdesign bietet zwar Vorteile in Bezug auf Zeit und Ressourcen, birgt jedoch auch einige Herausforderungen:
- Erfordernis von Fachwissen: Die Forscher müssen sowohl über Fachwissen im Bereich des primären Forschungsdesigns (quantitativ oder qualitativ) als auch im Bereich der Mixed-Methods-Forschung verfügen. Diese Doppelkompetenz ist für die erfolgreiche Umsetzung des eingebetteten Designs unerlässlich.
- Klarstellung des Zwecks zusätzlicher Daten: Der Zweck der Einbeziehung zusätzlicher qualitativer oder quantitativer Daten muss im Kontext der größeren Studie klar angegeben werden. Forscher können diese als primäre und sekundäre Zwecke in ihrer Studie formulieren.
- Zeitplan für die Erhebung qualitativer Daten: Die Bestimmung des Zeitpunkts für die Erhebung qualitativer Daten im Rahmen einer experimentellen Studie ist von entscheidender Bedeutung. Diese Entscheidung sollte sich an der Absicht orientieren, qualitative Daten einzubeziehen, sei es zur Information über das Interventionsdesign, zur Erforschung der Erfahrungen der Teilnehmer während der Behandlung oder zur Gewinnung von Erkenntnissen nach der experimentellen Studie.
- Herausforderungen bei der Integration von Ergebnissen: Da die beiden Methoden in einem eingebetteten Design in der Regel unterschiedliche Forschungsfragen behandeln, kann die Integration der Ergebnisse eine Herausforderung darstellen. Im Gegensatz zu einem konvergenten Design zielt das eingebettete Design jedoch nicht darauf ab, die Datensätze zusammenzuführen. Die Forscher können die Ergebnisse getrennt halten und sie sogar in separaten Publikationen veröffentlichen.
- Risiko der Behandlungsverzerrung: Bei experimentellen Studien, in denen während der Intervention qualitative Daten erhoben werden, besteht die Möglichkeit einer Verzerrung der Behandlung, die sich auf die Versuchsergebnisse auswirken könnte. Die Forscher müssen dieses Risiko bei der Planung der Studie sorgfältig berücksichtigen und mindern.
Beispiel für ein eingebettetes Forschungsdesign mit gemischten Methoden
Victor, Ross und Axford (2004) führten eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) durch, um eine Gesundheitsförderungsmaßnahme für Personen mit Kniearthrose zu bewerten. In dieser Studie wendeten sie ein eingebettetes Design an, das qualitative Daten aus den Tagebüchern der Teilnehmer und aus aufgezeichneten Gruppensitzungen in den vorwiegend quantitativen experimentellen Rahmen einbezog. Während sich die quantitative Komponente auf die Messung klinischer Ergebnisse wie Verbesserungen der körperlichen Gesundheit und des Selbstmanagements konzentrierte, ermöglichten die qualitativen Daten ein tieferes Verständnis der Erfahrungen der Teilnehmer. Durch die Erhebung dieser qualitativen Daten während der Intervention konnten die Forscher untersuchen, wie die Teilnehmer das Programm aufnahmen und wahrnahmen.
In ähnlicher Weise untersuchten Evans und Hardy (2002) die Auswirkungen einer Zielsetzungsintervention auf die Rehabilitation von verletzten Sportlern. In ihrem Versuchsplan wurden quantitative Ergebnisse wie Rehabilitationsbefolgung, Selbstwirksamkeit und psychologische Reaktionen auf die Verletzung gemessen. Zur Anreicherung dieser Ergebnisse fügten sie ein qualitatives Element ein, indem sie nach der Intervention halbstrukturierte Interviews mit den Teilnehmern durchführten.
Schlussfolgerung
Da die Forschungsfragen immer komplexer werden, kann ein Bedarf an Designs bestehen, die über die unterstützende Rolle der eingebetteten Methoden hinausgehen. An dieser Stelle kommen transformative und mehrphasige Designs ins Spiel. Das transformative Design ist besonders wertvoll, wenn die Forschung auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung oder der Interessenvertretung abzielt. Es integriert qualitative und quantitative Daten innerhalb eines Rahmens, der von einer spezifischen theoretischen Linse geleitet wird und sich oft auf marginalisierte oder unterrepräsentierte Gruppen konzentriert. Dieses Design zielt nicht nur darauf ab, Phänomene zu verstehen, sondern auch Veränderungen anzuregen, was es zu einer leistungsstarken Methode für Forscher macht, die sich für transformative Ergebnisse einsetzen.
In ähnlicher Weise erweitert das mehrphasige Design die Möglichkeiten gemischter Methoden, indem es mehrere Phasen der Datenerhebung und -analyse im Laufe der Zeit kombiniert. Dieser Ansatz ist ideal für groß angelegte Studien oder Längsschnittprojekte, bei denen sich in verschiedenen Phasen unterschiedliche Forschungsfragen ergeben. Durch die Integration sowohl qualitativer als auch quantitativer Komponenten über mehrere Phasen hinweg ermöglicht das Mehrphasendesign eine umfassende Untersuchung komplexer Themen und erfasst Veränderungen, Entwicklungen und Muster, die in einphasigen Studien möglicherweise übersehen werden.
In den nächsten Abschnitten dieses Leitfadens werden wir diese fortgeschrittenen Designs genauer untersuchen. Das Verständnis der transformativen und mehrphasigen Designs gibt den Forschern die Möglichkeit, differenziertere Forschungsfragen anzugehen, sich mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu befassen und zu sinnvollen Veränderungen in ihren Bereichen beizutragen.
Referenzen
- Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2016). Mixed Methods Research: A guide to the field. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2006). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2. Aufl.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Victor, C. R., Ross, F., & Axford, J. (2004). Erfassung der Laienperspektive in einer randomisierten Kontrollstudie über eine Gesundheitsförderungsmaßnahme für Menschen mit Kniearthrose. Gesundheitserwartungen, 7(3), 243-252
- Evans, L., & Hardy, L. (2002). Rehabilitation nach einer Verletzung: A goal-setting intervention study. Research Quarterly for Exercise and Sport, 73(3), 310-319