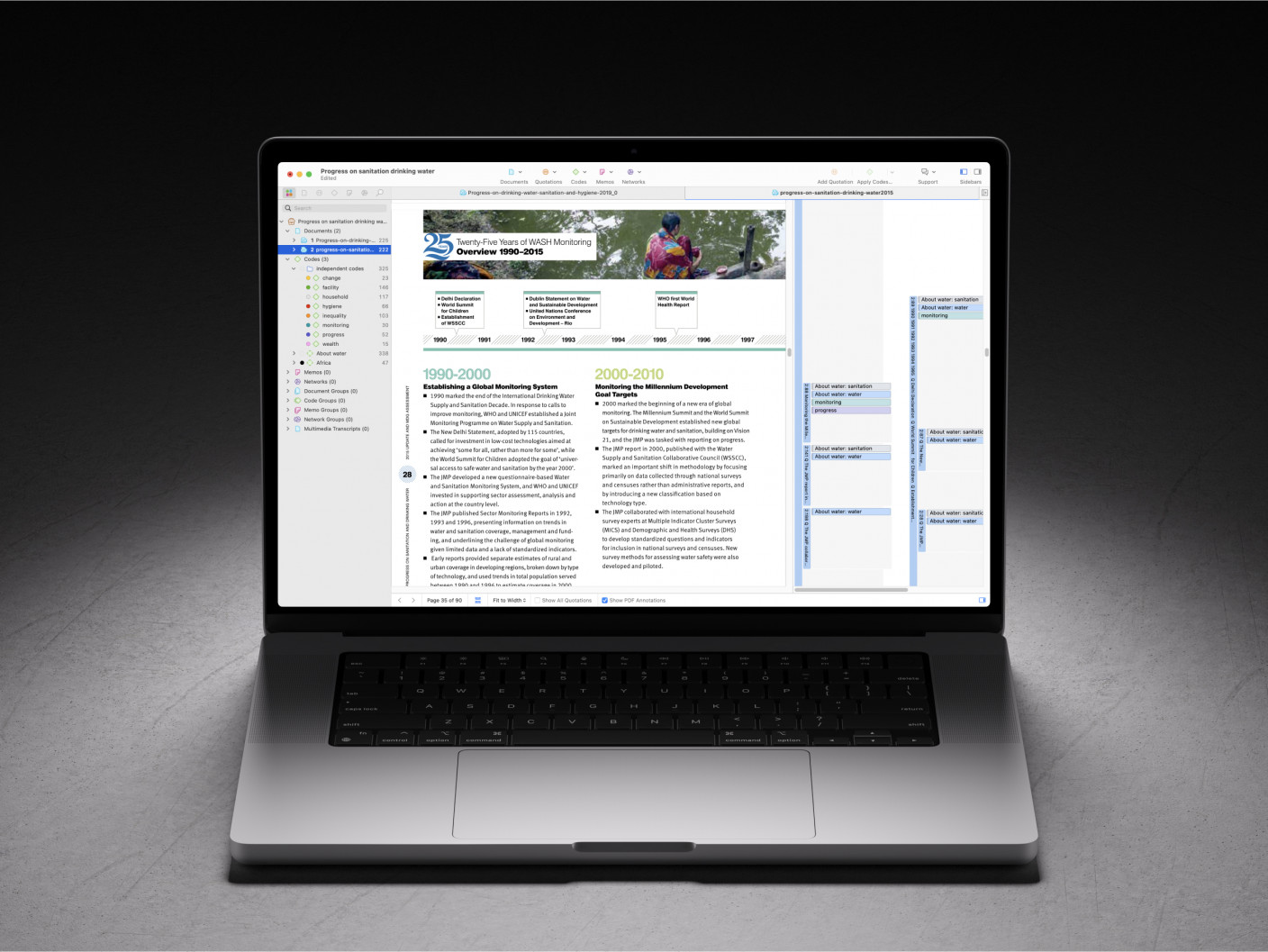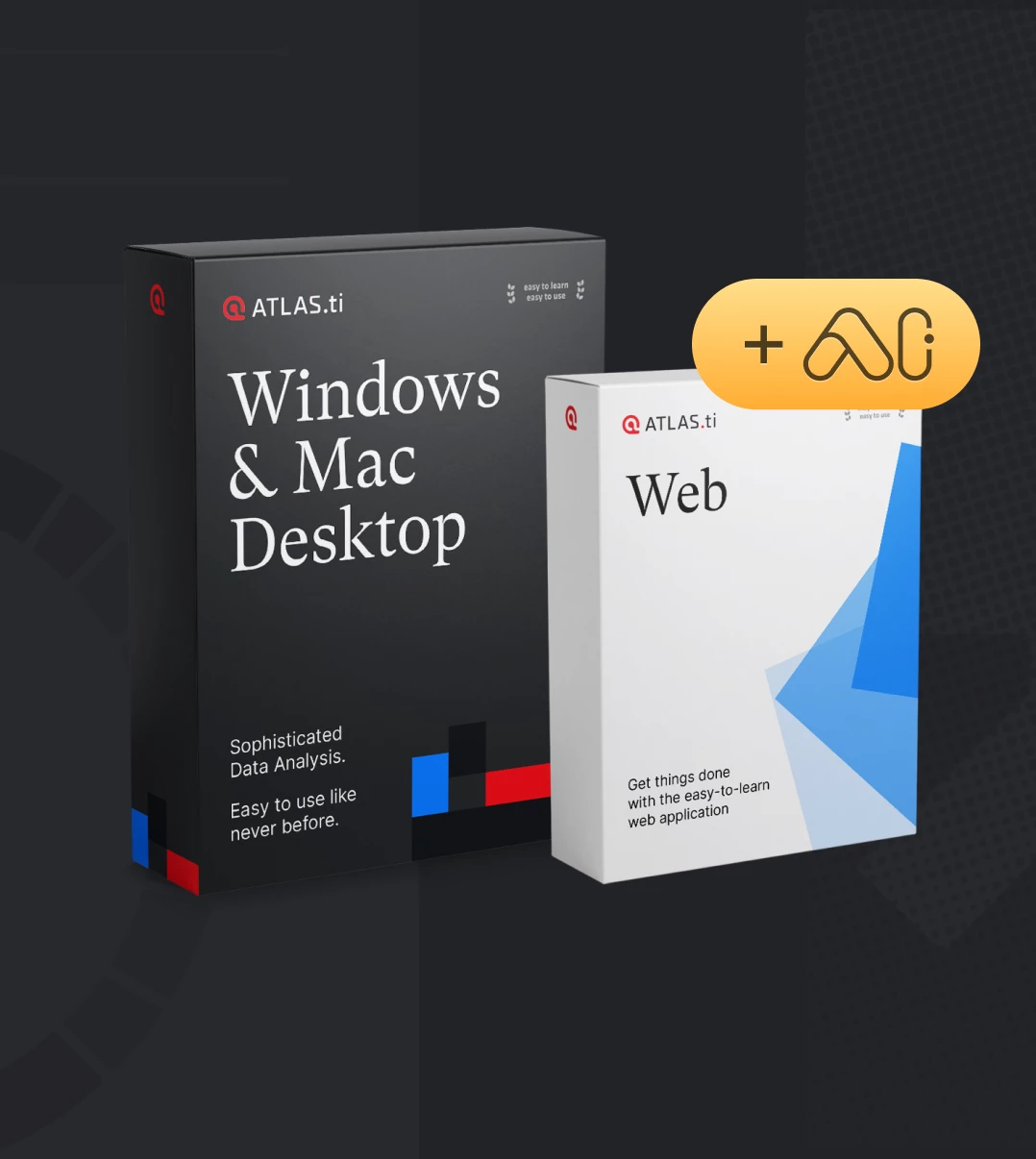Leitfaden für die Forschung mit gemischten Methoden
- Was ist Mixed-Methods-Forschung?
- Vorteile der Mixed-Methods-Forschung
- Herausforderungen in der Mixed-Methods-Forschung
- Häufige Fehler in der Mixed-Methods-Forschung
- Forschungsparadigmen mit gemischten Methoden
- Validität und Reliabilität in der Mixed-Methods-Forschung
- Ethische Überlegungen bei der Forschung mit gemischten Methoden
- Gemischte Methoden vs. Mehrfachmethodenforschung
- Forschungsdesigns mit gemischten Methoden
- Wie man das richtige Mixed-Methods-Design auswählt
- Konvergentes paralleles Design
- Erklärendes sequentielles Design
- Exploratives sequentielles Design
- Eingebettetes Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Transformatives Design mit gemischten Methoden
- Mehrphasiges Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Wie man Forschung mit gemischten Methoden durchführt
- Stichprobenstrategien in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenerhebung in der Mixed-Methods-Forschung
- Triangulation in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung
- Wie lassen sich quantitative und qualitative Daten integrieren?
- Wie interpretiert man Forschungsergebnisse aus gemischten Methoden?
- Software-Tools für die Datenanalyse mit gemischten Methoden
- Wie man einen Forschungsantrag für gemischte Methoden schreibt
- Wie schreibt man eine Forschungsarbeit mit gemischten Methoden?
- Ergebnisberichterstattung in der Mixed-Methods-Forschung
- Beispiele für Mixed-Methods-Forschung
- Wie zitiert man „Leitfaden zur Forschung mit gemischten Methoden“?
Transformatives Mixed-Methods-Design
Transformative Mixed-Methods-Designs gehen über die traditionellen Mixed-Methods-Designs hinaus und werden eingesetzt, wenn der Forscher einen theoretisch fundierten Rahmen verwendet. Transformative Mixed-Methods-Designs konzentrieren sich darauf, die Bedürfnisse von unterrepräsentierten oder marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu fördern. Der Forscher wird in das Forschungsdesign einbezogen, um Empathie und Sensibilität für die Erfahrungen der Teilnehmer zu erhöhen. Damit sollen spezifische Veränderungen empfohlen und die soziale Gerechtigkeit erhöht werden.
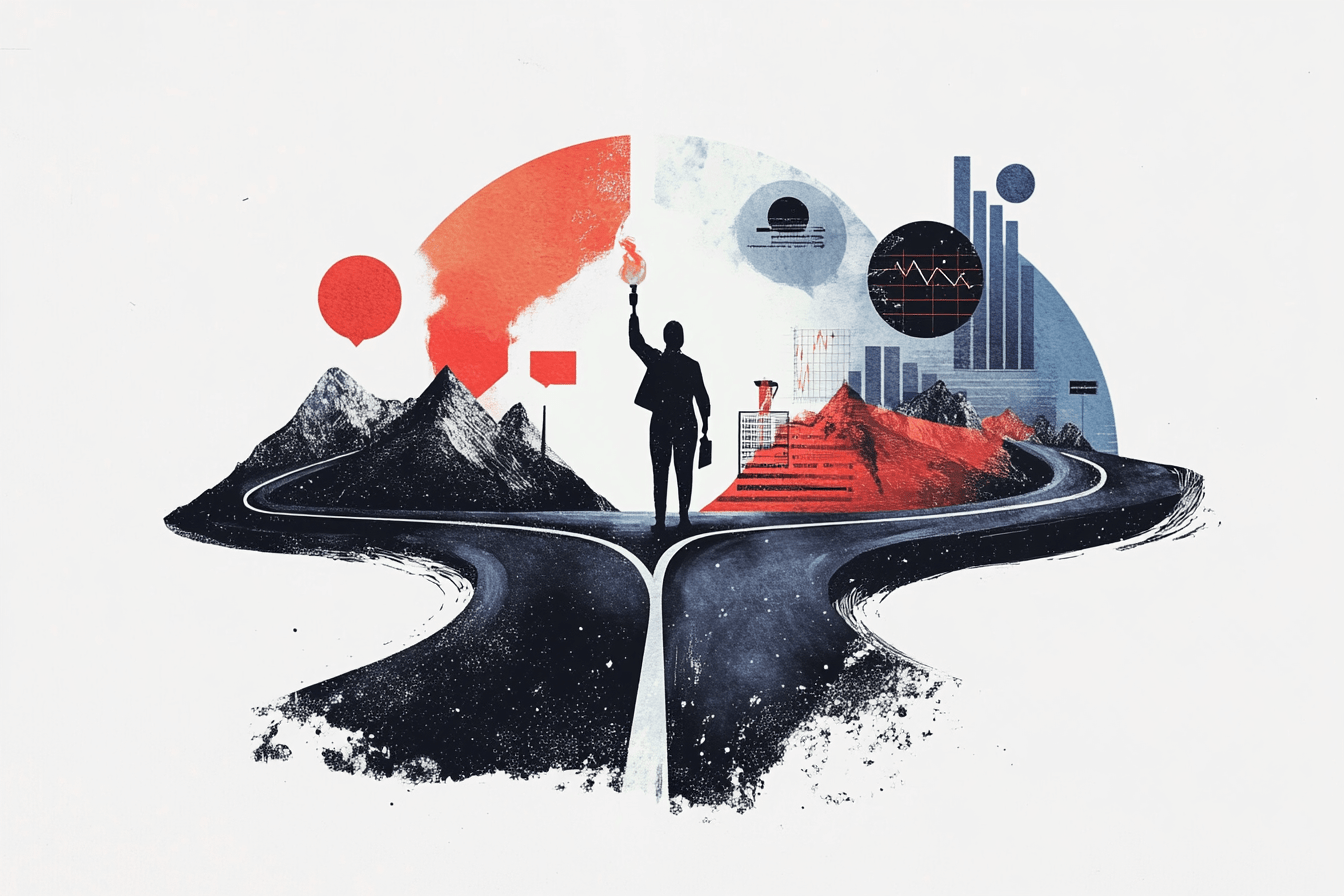
Einführung
Laut Creswell und Plano Clark (2011) ist das transformative Design aufgrund seines transformativen Charakters ein Diskussionsthema unter Forschern. Teddlie und Tashakkori (2009) lehnten ideologische Perspektiven als Kriterium für die Klassifizierung von Forschungsdesigns mit gemischten Methoden ab und argumentierten, dass sich die Designs eher auf den inhaltlichen Zweck der Studie als auf die methodischen Entscheidungen der Studie beziehen. Andererseits argumentierten andere Forscher ausdrücklich, dass die transformative Perspektive jede Phase der Forschung und des Designs beeinflusst.
Transformative Designs variieren je nach der Perspektive, die sie anwenden. Einige Designs beinhalten beispielsweise feministische, rassistische, ethnische, sexuelle Orientierungs- oder Behinderungstheorien (Mertens, 2009). Ihr Ziel ist es, die soziale Gerechtigkeit zu verbessern und politische Maßnahmen voranzutreiben, indem Ungleichgewichte aufgedeckt und Einzelpersonen und Gemeinschaften gestärkt werden. Die Methoden werden also eingesetzt, um Ziele wie die Infragestellung des Status quo und die Entwicklung von Lösungen voranzutreiben.
Forscher entscheiden sich in der Regel für diese Methode, wenn sie feststellen, dass eine Studie mit gemischten Methoden notwendig ist, um soziale Veränderungen anzugehen und die Bedürfnisse marginalisierter Bevölkerungsgruppen zu erkennen. Die Forscher müssen über eine gute Kenntnis des angewandten Rahmens verfügen und die Studie sorgfältig so durchführen, dass eine weitere Marginalisierung der untersuchten Bevölkerungsgruppe vermieden wird.
Philosophische Annahmen im transformativen Design
Das transformative Design wird von einem "übergreifenden" Paradigma geleitet, das politisches Handeln, Empowerment und veränderungsorientierte Perspektiven umfasst. Dieses Paradigma integriert Advocacy- und partizipatorische Weltanschauungen, um systemische Ungleichheiten anzugehen und Veränderungen durch Forschung zu fördern.
Forscher, die dieses Paradigma anwenden, konzentrieren sich aktiv auf die Befähigung entrechteter Gruppen. Die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern ist von zentraler Bedeutung. Die Teilnehmer werden in verschiedenen Phasen der Forschung einbezogen, z. B. bei der Definition von Fragen, der Datenerfassung und der Analyse der Ergebnisse. Das Konzept zielt nicht nur auf das Verständnis sozialer Phänomene ab, sondern auch auf die Nutzung der Ergebnisse als Instrument zur Durchsetzung konkreter Verbesserungen in Politik, Institutionen oder gesellschaftlichen Strukturen.
Wie konzipiert man eine transformative Mixed-Methods-Studie?
Nach Creswell und Plano Clark (2011) lässt sich der transformative Designprozess in vier Schritten zusammenfassen:
- Problemdefinition und Literaturrecherche: Bei der Definition des Forschungsproblems ist es wichtig, die Perspektiven verschiedener Gruppen zu berücksichtigen, insbesondere derjenigen, die von Diskriminierung und Unterdrückung betroffen sind. Durch eine gezielte und umfassende Literaturrecherche können Sie Anliegen aufdecken, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben. Durch den direkten Kontakt mit der Interessengemeinschaft wird sichergestellt, dass das Problem gemeinsam definiert wird und die Erfahrungen und Prioritäten der Betroffenen berücksichtigt werden. Der Aufbau von Vertrauen zu den Mitgliedern der Gemeinschaft ist von entscheidender Bedeutung und erfordert Transparenz, aktives Zuhören und nachhaltiges Engagement. Forscher sollten es vermeiden, sich auf defizitorientierte theoretische Konzepte zu stützen, die sich auf die Defizite marginalisierter Gruppen konzentrieren. Stattdessen sollten bei der Formulierung von Forschungsfragen sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden, um eine ausgewogene Perspektive zu bieten. Fragen, die die Machtdynamik und Autorität in Institutionen und Gemeinschaften untersuchen, können zu transformativen Einsichten führen und zu einem sinnvollen sozialen Wandel beitragen.
- Identifizieren Sie das Forschungsdesign: Um komplexe Themen effektiv anzugehen, bietet die Forschung mit gemischten Methoden einen robusten Ansatz, indem sie qualitative und quantitative Methoden miteinander verbindet. Diese Kombination ermöglicht es den Forschern, die Vielschichtigkeit der Probleme zu erfassen und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Beteiligten zu erfüllen. Ethische Überlegungen müssen das Forschungsdesign untermauern und die Würde, Autonomie und das Wohlergehen aller Teilnehmer sicherstellen. Es muss vermieden werden, Ungleichheiten zu schaffen oder zu verschärfen, z. B. indem bestimmten Gruppen in experimentellen Verfahren Behandlungen oder Interventionen vorenthalten werden. Ein durchdachtes und gerechtes Forschungsdesign erhöht die Aussagekraft der Ergebnisse und fördert das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern.
- Datenerhebungsinstrumente und -methoden: Das Design der Datenerhebung sollte darauf abzielen, dass die untersuchte Gemeinschaft davon profitiert. Dazu gehört, dass die verwendeten Methoden glaubwürdig und für die Teilnehmer akzeptabel sind. Die Kommunikation mit den Gemeindemitgliedern während der Datenerhebung sollte effektiv und kultursensibel sein, um eine echte Beteiligung und ein Engagement zu fördern. Darüber hinaus sollte die Datenerhebung so strukturiert sein, dass sie Möglichkeiten zur Beteiligung der Gemeinschaft an der Förderung des sozialen Wandels eröffnet. Durch die Integration dieser Überlegungen in die Forschung wird die Datenerhebung zu einem kollaborativen Prozess, der die Teilnehmer befähigt und die Relevanz und Wirkung der Ergebnisse erhöht.
- Analyse, Interpretation, Berichterstattung und Nutzung der Ergebnisse: Die Analyse der Forschungsergebnisse sollte ein iterativer Prozess sein, der offen für die Entwicklung neuer Hypothesen bleibt. Dieser Ansatz ermöglicht eine tiefere Erkundung aufkommender Muster und Trends. Untergruppenanalysen sind besonders wichtig, um unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Gruppen zu ermitteln und ein differenziertes Verständnis der Daten zu ermöglichen. Die Aufbereitung der Ergebnisse sollte sich darauf konzentrieren, Machtverhältnisse innerhalb des untersuchten Kontexts zu beleuchten und so zur Klärung systemischer Dynamiken beizutragen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse in einer Weise, die das Handeln und den sozialen Wandel erleichtert, ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Forschung zu sinnvollen Ergebnissen beiträgt. Durch die Präsentation der Ergebnisse in einer zugänglichen und umsetzbaren Weise können die Forscher die Bemühungen unterstützen, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und den Fortschritt innerhalb der Gemeinschaft zu fördern.

Stärken
Forscher verwenden transformative Mixed-Methods-Designs, um traditionelle Mixed-Methods-Designs in transformative Forschung zu integrieren. Diese Designs teilen die Vorteile der gemischten Methoden und bieten gleichzeitig zusätzliche Vorteile:
- Die Forscher nutzen eine anwaltschaftliche oder emanzipatorische Perspektive und betonen soziale Gerechtigkeit und Gleichheit.
- Dieser Ansatz unterstützt die aktive Beteiligung der Teilnehmer am Forschungsprozess und fördert die Zusammenarbeit und Vertretung.
- Die Forschung zielt darauf ab, Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten anzusprechen und zu beseitigen.
- Durch die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden wird der Nutzen der Ergebnisse für Gemeinschaften und Interessengruppen erhöht und sichergestellt, dass sie relevant und umsetzbar sind.
Herausforderungen
Forscher können bei der Anwendung des transformativen Designs auch mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. Bei diesem Ansatz können ähnliche verfahrenstechnische Schwierigkeiten auftreten wie bei grundlegenden Mixed-Methods-Designs. Darüber hinaus birgt das transformative Design diese einzigartigen Herausforderungen:
- Die Literatur bietet nur begrenzte Anhaltspunkte für die Umsetzung gemischter Methoden in einer transformativen Form. Um dieses Problem zu lösen, können Sie veröffentlichte Mixed-Methods-Studien durchsehen, die eine transformative Linse verwenden.
- Möglicherweise müssen Sie den transformativen Ansatz rechtfertigen, indem Sie seine philosophischen und theoretischen Grundlagen im Studienvorschlag und -bericht ausdrücklich erläutern.
- Der Aufbau von Vertrauen bei den Teilnehmern ist entscheidend. Um die Effektivität und ethische Integrität der Studie zu gewährleisten, muss sie auch kultursensibel durchgeführt werden.
Transformative Gestaltungsvarianten
Transformative Mixed-Methods-Designs integrieren qualitative und quantitative Forschung und legen dabei den Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit, Interessenvertretung und marginalisierte Stimmen. Diese Designs stützen sich auf einen theoretischen Rahmen, der die Datenerhebung, -analyse und -interpretation beeinflusst und sicherstellt, dass die Forschungsergebnisse Machtungleichgewichte berücksichtigen und zu handlungsorientierten Ergebnissen führen. Es gibt drei primäre transformative Varianten, die jeweils einen bestimmten Blickwinkel betonen:
Die transformative Variante mit feministischer Linse
Diese Variante basiert auf der feministischen Theorie und zielt darauf ab, geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu bekämpfen, indem die Stimmen von Frauen und geschlechtsspezifischen Minderheiten verstärkt werden. Forscher, die diesen Ansatz verfolgen, legen häufig Wert auf partizipative Methoden, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer zum Forschungsprozess beitragen und die Ergebnisse zu spürbaren Verbesserungen der Geschlechtergerechtigkeit führen. Zu den Methoden der Datenerhebung gehören Tiefeninterviews, Fokusgruppen und Umfragen, die darauf abzielen, geschlechtsspezifische Erfahrungen zu untersuchen. Quantitative Daten werden häufig verwendet, um systemische Diskriminierungsmuster aufzuzeigen, während qualitative Erkenntnisse die individuellen Erfahrungen vertiefen.
Die Linse der Behinderung transformative Variante
Diese Variante basiert auf der Behindertenforschung und setzt sich für die Rechte und die Integration von Menschen mit Behinderungen ein. Die in diesem Rahmen durchgeführte Forschung stellt ableistische Perspektiven in Frage und betont Zugänglichkeit, Inklusion und die gelebten Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen. Die Methoden der Datenerhebung umfassen häufig partizipative Forschung, bei der Menschen mit Behinderungen Forschungsinstrumente mitgestalten und zur Datenauswertung beitragen. Mixed-Methods-Ansätze helfen dabei, sowohl statistische Trends bei der Zugänglichkeit und der Bereitstellung von Dienstleistungen als auch die nuancierten persönlichen Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen zu erfassen.
Die sozioökonomische Klassenlinse als transformative Variante
Diese Variante konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Ungleichheiten und die mit der sozialen Klasse verbundenen Ungleichheiten. Sie ist oft in der kritischen Theorie verwurzelt und betont die strukturellen Barrieren, die Armut und soziale Ausgrenzung aufrechterhalten. Forscher, die diesen Ansatz verwenden, untersuchen, wie der wirtschaftliche Status den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen Ressourcen beeinflusst. Quantitative Daten können Ungleichheiten in Bezug auf Einkommen, Beschäftigung und Bildung aufdecken, während qualitative Methoden einen tieferen Einblick in die Lebenserfahrungen von wirtschaftlich marginalisierten Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Dieser Ansatz umfasst häufig gemeinschaftsorientierte Forschung, um sich für politische Maßnahmen zur Förderung der sozialen Mobilität und Gerechtigkeit einzusetzen.
Beispiele und Schlüsselstudien
In einer Studie von Sweetman, Badiee und Creswell (2010) untersuchten sie 13 Studien, die den transformativen Rahmen anwenden, und bewerteten sein Potenzial für die Behandlung von Fragen der sozialen Gerechtigkeit und die Stärkung marginalisierter Gemeinschaften. In der Studie erkannten die Autoren 10 transformative Kriterien, darunter:
Gemeinschaftsrelevantes Problem: Nimmt die Studie offen Bezug auf ein Problem, das eine marginalisierte Gemeinschaft betrifft?
Theoretische Ausrichtung: Geben die Autoren ausdrücklich eine theoretische Ausrichtung an, wie z. B. feministische oder kritische Ethnie-Theorie?
Wohltätigkeitsorientierte Forschungsfragen: Wurden die Forschungsfragen oder -ziele mit einer anwaltschaftlichen Haltung verfasst?
Erörterung von Vielfalt und Unterdrückung: Enthält die Literaturübersicht Diskussionen zu Themen wie Unterdrückung, Ungleichheit und Vielfalt?
Angemessene Kennzeichnung der Teilnehmer: Werden die Teilnehmer auf eine Weise bezeichnet, die Respekt und Genauigkeit widerspiegelt?
Gemeinschaftsnutzen: Bieten die Datenerhebung und die Ergebnisse einen greifbaren Nutzen für die untersuchte Gemeinschaft?
Engagement der Teilnehmer: Haben die Teilnehmer den Forschungsprozess initiiert oder sich aktiv daran beteiligt?
Machtverhältnisse: Wird in den Ergebnissen die Machtdynamik im Kontext der Forschung angesprochen?
Erleichterung des sozialen Wandels: Werden die Ergebnisse genutzt, um einen sinnvollen sozialen Wandel zu fördern oder zu erleichtern?
Ausdrückliche Verwendung eines transformativen Rahmens: Weisen die Autoren ausdrücklich auf die Verwendung eines transformativen Rahmens in ihrer Studie hin?
Newman und Wyly (2006) verwendeten ein transformatives Design, um die Auswirkungen der Gentrifizierung in New York City zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Verdrängung. Der Artikel kritisiert die gängigen Behauptungen, dass die Gentrifizierung allen zugute kommt und nur minimale Verdrängung verursacht. Die Autoren stellen die häufig von städtischen Entscheidungsträgern vertretene Auffassung in Frage, dass Gentrifizierung von Natur aus gut ist, selbst für die negativ Betroffenen.
Die Autoren führten eine Evaluierung mit gemischten Methoden durch, wobei sie die New York City Housing and Vacancy Survey und Interviews vor Ort nutzten. Sie analysierten die Verdrängungstrends von 1991 bis 2002 und untersuchten deren Umfang und Auswirkungen. Das Studiendesign entspricht einigen transformativen Grundsätzen wie der Konzentration auf die Auswirkungen der Gentrifizierung auf marginalisierte Gruppen und die Bekämpfung systemischer städtischer Ungerechtigkeiten. Die Studie setzte sich jedoch nicht direkt für die Interessenvertretung ein oder schlug eine handlungsorientierte Agenda vor, um die Vertreibung anzugehen, und bezog auch keine Gemeindemitglieder als Mitforscher oder aktive Teilnehmer in den Forschungsprozess ein.
Schlussfolgerung
Transformative Designs in der Mixed-Methods-Forschung konzentrieren sich darauf, soziale Gerechtigkeit, Interessenvertretung und sinnvolle Veränderungen zu fördern. Im Gegensatz zu konvergenten, erklärenden sequentiellen, explorativen sequentiellen oder eingebetteten Designs, die darauf abzielen, Daten aus Gründen der Validität oder Komplementarität zu integrieren, beinhalten transformative Designs eine starke philosophische Grundlage, die in Gerechtigkeit und Inklusion verwurzelt ist. Sie gehen über das Verstehen von Phänomenen hinaus, indem sie aktiv Veränderungen fördern, marginalisierten Stimmen Gehör verschaffen und Machtdynamiken innerhalb des Forschungsprozesses in Frage stellen. Mit einem klaren Fokus auf ethischen Überlegungen, partizipativer Beteiligung und sozialer Wirkung schaffen transformative Designs eine Forschung, die sowohl akademisch anspruchsvoll als auch ein Katalysator für Veränderungen in der realen Welt ist.
Referenzen
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2. Aufl.)
- Sweetman, D., Badiee, M., & Creswell, J. W. (2010). "Use of the Transformative Framework in Mixed Methods Studies". Qualitative Inquiry, 16(6), 441-454.
- Newman, K., & Wyly, E. K. (2006). "The Right to Stay Put, Revisited: Gentrification and Resistance to Displacement in New York City". Urban Studies, 43(1), 23-57.