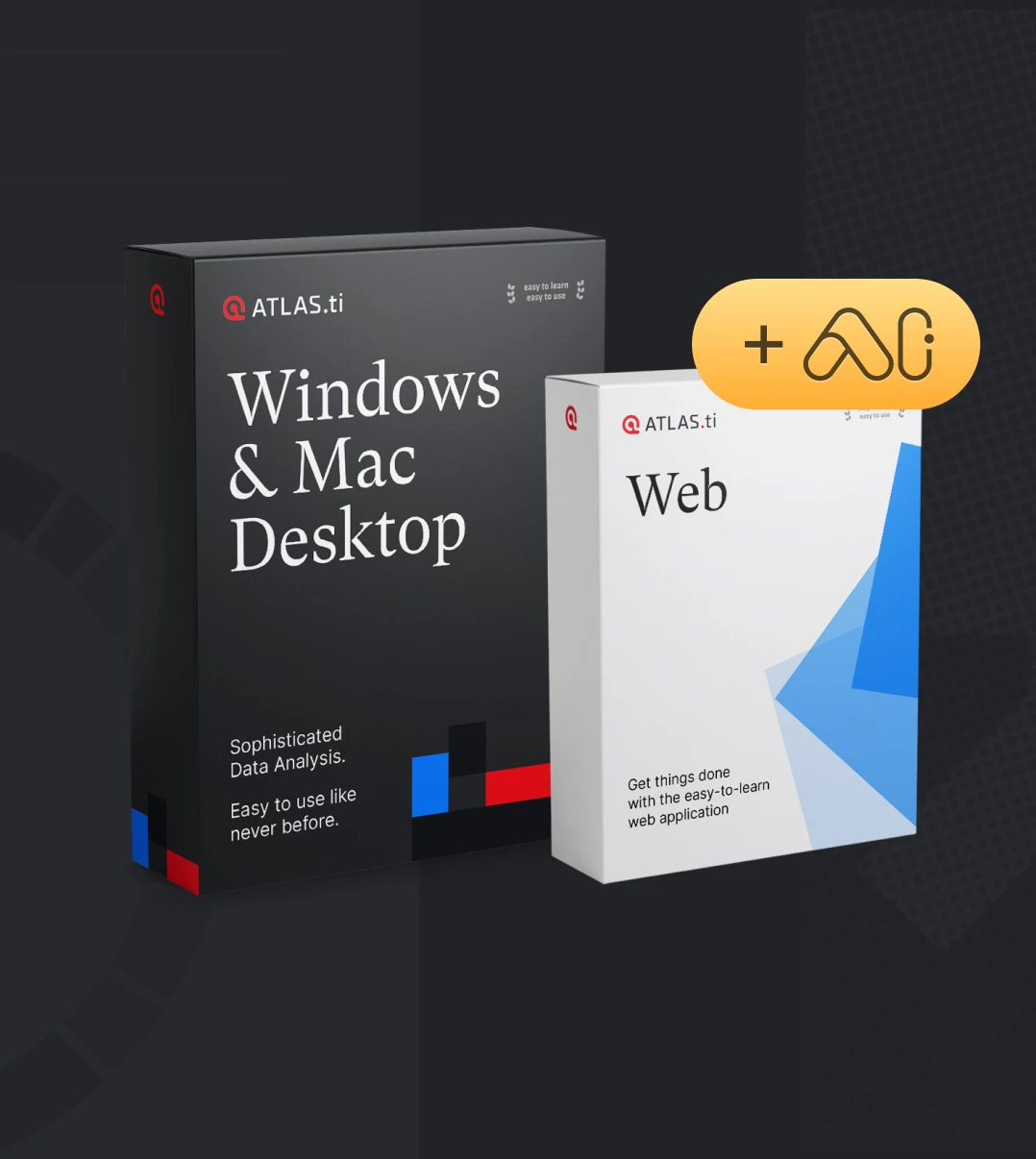Leitfaden für die Forschung mit gemischten Methoden
- Was ist Mixed-Methods-Forschung?
- Vorteile der Mixed-Methods-Forschung
- Herausforderungen in der Mixed-Methods-Forschung
- Häufige Fehler in der Mixed-Methods-Forschung
- Forschungsparadigmen mit gemischten Methoden
- Validität und Reliabilität in der Mixed-Methods-Forschung
- Ethische Überlegungen bei der Forschung mit gemischten Methoden
- Gemischte Methoden vs. Mehrfachmethodenforschung
- Forschungsdesigns mit gemischten Methoden
- Wie man das richtige Mixed-Methods-Design auswählt
- Konvergentes paralleles Design
- Erklärendes sequentielles Design
- Exploratives sequentielles Design
- Eingebettetes Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Transformatives Design mit gemischten Methoden
- Mehrphasiges Forschungsdesign mit gemischten Methoden
- Wie man Forschung mit gemischten Methoden durchführt
- Stichprobenstrategien in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenerhebung in der Mixed-Methods-Forschung
- Triangulation in der Mixed-Methods-Forschung
- Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung
- Wie lassen sich quantitative und qualitative Daten integrieren?
- Wie interpretiert man Forschungsergebnisse aus gemischten Methoden?
- Software-Tools für die Datenanalyse mit gemischten Methoden
- Wie man einen Forschungsantrag für gemischte Methoden schreibt
- Wie schreibt man eine Forschungsarbeit mit gemischten Methoden?
- Ergebnisberichterstattung in der Mixed-Methods-Forschung
- Beispiele für Mixed-Methods-Forschung
- Wie zitiert man „Leitfaden zur Forschung mit gemischten Methoden“?
Forschungsparadigmen mit gemischten Methoden
Ein Forschungsparadigma ist ein grundlegender Rahmen, der die Durchführung der Forschung leitet. Es spiegelt die Überzeugungen des Forschers über die Natur der Realität (Ontologie), die Art und Weise, wie Wissen geschaffen und verstanden wird (Epistemologie), und die Methoden, die zur Sammlung und Analyse von Daten verwendet werden (Methodologie), wider. Diese Überzeugungen prägen die Art und Weise, wie Forscher Studien konzipieren, durchführen und interpretieren.
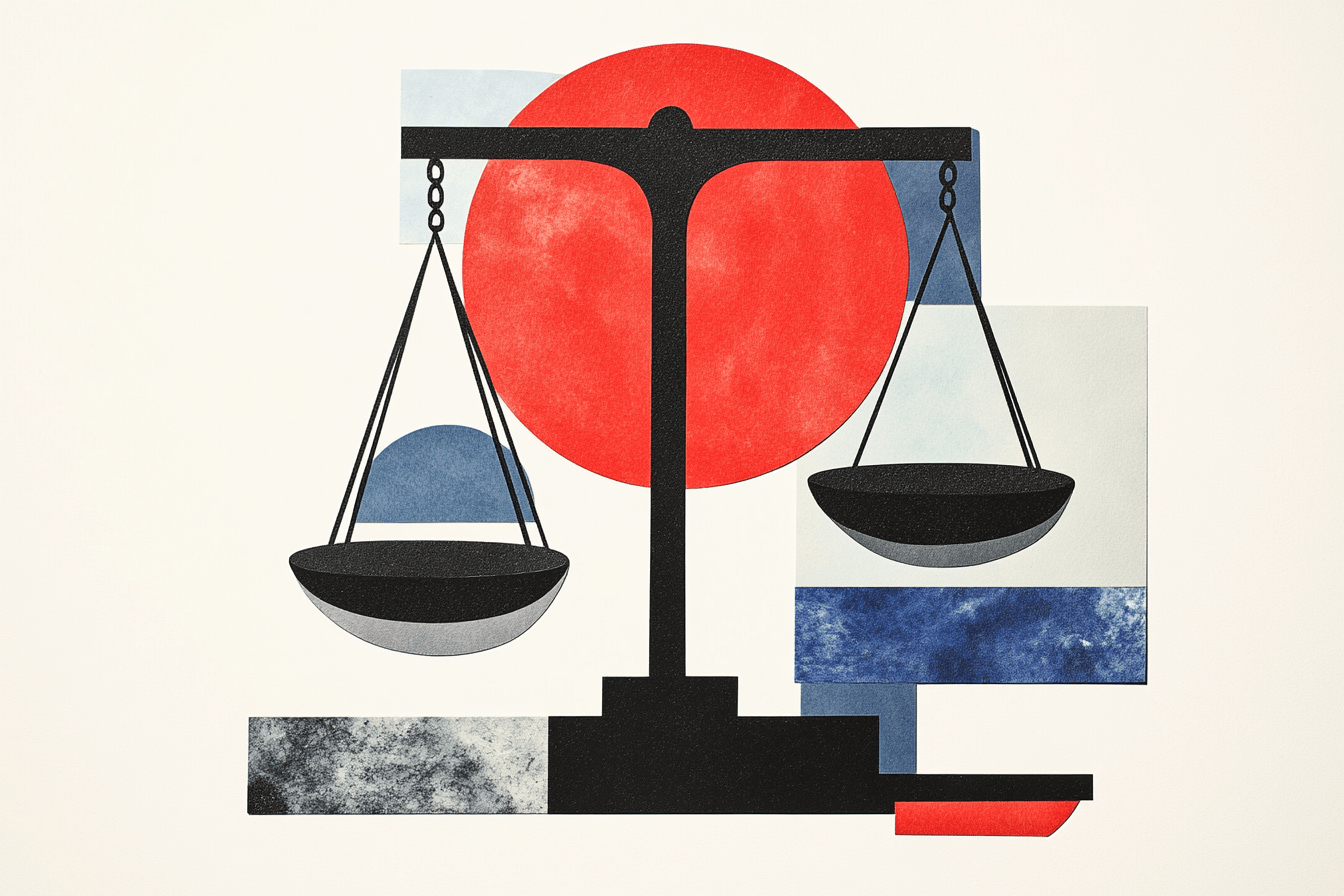
Einführung
Ein Mixed-Methods-Forschungsparadigma ist ein umfassendes Glaubenssystem, das die Art und Weise, wie Forschung konzeptualisiert und durchgeführt wird, untermauert. Es ist aus der Wissenschaftsphilosophie hervorgegangen und stellt einen Rahmen für das Verständnis und die Erforschung der Welt dar. Paradigmen leiten Forscher bei der Identifizierung geeigneter Fragen, Methoden und Interpretationen an und bilden die Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen.
Der Begriff des Forschungsparadigmas erlangte Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Arbeiten von Thomas Kuhn an Bedeutung. In seinem bahnbrechenden Buch The Structure of Scientific Revolutions (1962) beschrieb Kuhn Paradigmen als allgemein anerkannte wissenschaftliche Errungenschaften, die Forschern bei der Lösung von Problemen als Richtschnur dienen. Er wies auch darauf hin, dass sich Paradigmen durch "Paradigmenwechsel" weiterentwickeln - Phasen, in denen neue Paradigmen die vorherrschenden Rahmenkonzepte aufgrund von Anomalien ersetzen, die das bestehende Paradigma nicht erklären kann.
Seit Kuhns Arbeit werden Paradigmen in allen Disziplinen angewandt und beeinflussen die Forschungsansätze in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Die Unterteilung in qualitative, quantitative und methodengemischte Paradigmen spiegelt ihre Anpassung an verschiedene Bereiche wider.
Die Wahl eines Forschungsparadigmas beeinflusst jeden Aspekt einer Studie, von der Formulierung der Fragestellung bis zur Interpretation der Daten. Während sich der Positivismus durch den Nachweis von Kausalität auszeichnet, deckt der Interpretivismus nuancierte Bedeutungen auf, der Pragmatismus legt den Schwerpunkt auf umsetzbare Ergebnisse, die kritische Theorie treibt den sozialen Wandel voran und die gemischten Methoden verbinden verschiedene Perspektiven. Jedes Paradigma bietet einzigartige Stärken und ist für bestimmte Forschungsziele und -kontexte geeignet, was unterstreicht, wie wichtig es ist, die Wahl der Methoden auf die Art der Untersuchung abzustimmen.
Forschungsparadigmen leiten den Forschungsprozess und definieren seine Struktur. Sie bilden die philosophische Grundlage für die Studie. Paradigmen bestimmen, wie Forscher die Realität sehen und an Wissen herangehen. Sie gewährleisten die Kohärenz zwischen dem Forschungsproblem und den gewählten Methoden. Forscher verwenden Paradigmen, um Strenge und Gültigkeit zu verbessern. Sie bieten klare Richtlinien für die Erhebung und Analyse von Daten. Paradigmen beeinflussen auch die ethische Entscheidungsfindung und die Interpretation der Ergebnisse. Sie helfen den Forschern, Transparenz zu wahren und ihre Annahmen zu reflektieren. Forschung, die sich auf ein Paradigma stützt, kann mehr Klarheit und Relevanz erlangen und einen sinnvollen Beitrag zu Wissen und Praxis leisten.
Die Paradigmen-Debatte
Die Paradigmendebatte in der Mixed-Methods-Forschung entstand in den 1970er und 1980er Jahren, als qualitative Forscher die Dominanz quantitativer Ansätze in Frage stellten (Creswell und Plano Clark, 2018). Das Kernproblem war die Überzeugung, dass qualitative und quantitative Forschung auf grundlegend unterschiedlichen philosophischen Annahmen beruhen. Qualitative Forschung ist mit konstruktivistischen oder interpretivistischen Paradigmen verbunden, die sich auf subjektive Erfahrungen und den Kontext konzentrieren, während quantitative Forschung mit positivistischen oder post-positivistischen Paradigmen verbunden ist, die Objektivität, Messung und Verallgemeinerbarkeit betonen. Dies warf eine wichtige Frage auf: Könnten diese scheinbar unvereinbaren Paradigmen in einer einzigen Studie effektiv kombiniert werden?
Diese Debatte hat zwei gegensätzliche Lager hervorgebracht: Puristen und Pragmatiker. Die Puristen (Rossman & Wilson, 1985) vertraten die Ansicht, dass die Vermischung von Methoden die Integrität beider Ansätze gefährde, da beide auf unterschiedlichen erkenntnistheoretischen und ontologischen Grundlagen beruhten. Im Gegensatz dazu vertraten die Pragmatiker die Ansicht, dass die Wahl der Methoden von den Forschungsfragen und nicht von starren philosophischen Grenzen geleitet werden sollte. Sie argumentierten, dass die Kombination von Methoden ein umfassenderes Verständnis von Forschungsproblemen ermöglichen könne.
Die Debatte erreichte ihren Höhepunkt 1994 auf der Tagung der American Evaluation Association, auf der beide Seiten starke Argumente vorbrachten. Wissenschaftler wie Denzin und Lincoln (2005) sowie Mertens und Tarsilla (2015) begannen jedoch, die strengen Grenzen zwischen den Paradigmen in Frage zu stellen. Sie schlugen vor, dass qualitative und quantitative Methoden mit verschiedenen Weltanschauungen verbunden werden können, ohne dass es zu methodischen Konflikten kommt, und förderten flexiblere Forschungsansätze.
Mit der zunehmenden Popularität der Mixed-Methods-Forschung entstanden auch neue Perspektiven. Die Situationsforscher passten ihre Methoden an spezifische Forschungskontexte an, während die Pragmatiker den Schwerpunkt auf die praktische Anwendbarkeit legten und sich darauf konzentrierten, wie gut die Methoden den Forschungsfragen entsprachen, anstatt sich an philosophische Reinheit zu halten. Dieser Wandel unterstrich den Wert der Kombination von Methoden zur Verbesserung der Forschungsergebnisse.
Mit der Akzeptanz des Pragmatismus als philosophische Grundlage für die Forschung mit gemischten Methoden flaute die Debatte schließlich ab. Wissenschaftler wie Tashakkori und Teddlie (1998) förderten den Pragmatismus und konzentrierten sich auf praktische Lösungen statt auf die strikte Einhaltung von Paradigmen. Greene und Caracelli (1997) betonten ebenfalls, wie wichtig es ist, explizit anzugeben, wann und warum verschiedene Paradigmen angewendet werden. Dieser Entschluss führte zu einem integrierteren, flexibleren Forschungsansatz, der die komplementären Stärken sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden schätzt.

Gemischte Methoden der Forschung
Um zu verstehen, wie die Philosophie in das Design einer Mixed-Methods-Studie passt, ist ein Rahmen unerlässlich. Die Konzeptualisierung von Crotty (1998) bietet eine nützliche Struktur für die Positionierung der Philosophie im Forschungsdesign. Nach Crotty gibt es vier Schlüsselelemente, die an der Entwicklung eines Forschungsvorschlags oder einer Studie beteiligt sind: philosophische Annahmen, theoretische Linse, Methodologie und Methoden. Diese Elemente sind miteinander verknüpft, wobei jede Ebene auf der vorhergehenden aufbaut.
Auf der weitesten Ebene stehen die philosophischen Annahmen, die grundlegende Überzeugungen über das Wissen, die so genannte Epistemologie, und die Natur der Realität, die so genannte Ontologie, umfassen. Diese Annahmen bestimmen, wie Forscher die Welt verstehen und wie Wissen erzeugt wird. So können Forscher beispielsweise postpositivistisch an eine objektive Realität glauben, die gemessen werden kann, oder konstruktivistisch davon ausgehen, dass die Realität subjektiv und durch persönliche Erfahrungen geprägt ist.
Diese philosophischen Annahmen bilden die Grundlage für die Verwendung einer theoretischen Linse oder Haltung, die den Forschungsschwerpunkt und die Interpretation bestimmt. Theoretische Linsen können aus sozialwissenschaftlichen Theorien (wie der kritischen Theorie) oder aus emanzipatorischen Perspektiven (wie feministischen oder rassistischen Theorien) stammen. Der theoretische Blickwinkel bietet eine Möglichkeit, das Forschungsproblem zu formulieren, die Ergebnisse zu interpretieren und den sozialen oder kulturellen Kontext der Studie zu verstehen.
Die theoretische Sichtweise beeinflusst dann die Methodik, die sich auf die Gesamtstrategie oder den Aktionsplan der Studie bezieht. Zur Methodik gehört auch das Forschungsdesign - egal ob es sich um qualitative, quantitative oder gemischte Methoden handelt. In der Forschung mit gemischten Methoden ist die Methodik besonders wichtig, weil sie qualitative und quantitative Ansätze integriert, um komplexe Forschungsfragen zu beantworten. Gemischte Methoden werden oft nicht nur als eine Methode, sondern als eine Methodologie betrachtet, da sie den gesamten Forschungsprozess von der Datenerhebung bis zur Interpretation leiten.
Schließlich bestimmt die Methodik die Methoden, d. h. die spezifischen Techniken oder Verfahren, die zur Sammlung, Analyse und Interpretation von Daten eingesetzt werden. Dazu gehören Aktivitäten wie die Durchführung von Interviews, die Verteilung von Umfragen oder die statistische Analyse. In der Forschung mit gemischten Methoden werden diese Techniken kombiniert, um ein umfassendes Verständnis des Forschungsproblems zu ermöglichen.
Philosophische Annahmen in der Forschung
Im Mittelpunkt der Forschung mit gemischten Methoden stehen philosophische Annahmen oder Weltanschauungen, die die Untersuchung leiten. Begriffe wie Paradigma (nach Thomas Kuhn, 1970) und Weltanschauung werden oft synonym verwendet, um diese leitenden Überzeugungen zu beschreiben. Ein Paradigma bezieht sich auf eine Reihe von gemeinsamen Überzeugungen, Werten und Praktiken innerhalb einer wissenschaftlichen Gemeinschaft. In der Mixed-Methods-Forschung wird jedoch häufig der Begriff Weltanschauung bevorzugt, da er umfassendere Überzeugungen über Wissen widerspiegelt, die nicht auf bestimmte akademische Disziplinen beschränkt sind.
Es gibt vier wichtige Weltanschauungen, die üblicherweise mit der Mixed-Methods-Forschung in Verbindung gebracht werden:
- Postpositivismus: Diese häufig mit der quantitativen Forschung verbundene Weltanschauung betont den Determinismus (Ursache-Wirkungs-Beziehungen), den Reduktionismus (Konzentration auf bestimmte Variablen) und das Testen von Hypothesen zur Verfeinerung von Theorien.
- Konstruktivismus: Der Konstruktivismus wird mit der qualitativen Forschung in Verbindung gebracht und konzentriert sich auf die subjektiven Erfahrungen des Einzelnen. Wissen wird durch soziale Interaktionen ko-konstruiert und durch persönliche Geschichten und Kontexte geprägt.
- Transformative Weltanschauung: Diese Weltanschauung hat ihre Wurzeln im Bereich der sozialen Gerechtigkeit und der Interessenvertretung und befasst sich mit Themen wie Befähigung, Marginalisierung und Ungleichheit. Forscher, die diese Haltung einnehmen, arbeiten mit marginalisierten Gemeinschaften zusammen, um den sozialen Wandel zu fördern.
- Pragmatismus: Der Pragmatismus ist eng mit der Forschung mit gemischten Methoden verbunden und konzentriert sich auf die praktische Anwendung der Forschung. Er betont die Bedeutung der Forschungsfrage gegenüber starren methodologischen Regeln und fördert einen flexiblen, problemlösenden Ansatz, der sowohl qualitative als auch quantitative Methoden einsetzt, um reale Probleme zu lösen.
Diese Weltanschauungen unterscheiden sich in Bezug auf die wichtigsten philosophischen Annahmen, einschließlich der Ontologie (die Natur der Realität), der Erkenntnistheorie (wie Wissen entsteht), der Axiologie (die Rolle von Werten in der Forschung), der Methodologie (der Prozess der Forschungsdurchführung) und der Rhetorik (die in der Forschung verwendete Sprache). Postpositivisten glauben beispielsweise an eine einzige, objektive Realität, die gemessen werden kann, während Konstruktivisten die Realität als vielfältig und durch persönliche Erfahrungen geprägt betrachten. Transformative Forscher betrachten die Realität durch die Brille sozialer und kultureller Identitäten, während Pragmatiker flexibel sind und je nach Forschungskontext sowohl singuläre als auch multiple Realitäten anerkennen.
Methodisch arbeiten Postpositivisten von oben nach unten, wobei sie mit Theorien und Hypothesen beginnen und diese dann durch Datenerhebung überprüfen. Im Gegensatz dazu arbeiten Konstruktivisten von unten nach oben und nutzen die Perspektiven der Teilnehmer, um umfassendere Themen und Theorien zu entwickeln. Transformative Forscher betreiben kooperative, partizipative Forschung mit den Beteiligten, während Pragmatiker induktive und deduktive Ansätze kombinieren und qualitative und quantitative Daten integrieren, um herauszufinden, was am besten funktioniert.
Crottys Rahmen trägt dazu bei, philosophische Annahmen als Grundlage für das Forschungsdesign zu positionieren. Wenn Forscher verstehen, wie Weltanschauungen, theoretische Linsen, Methodologie und Methoden miteinander verbunden sind, können sie robuste, kohärente Studien mit gemischten Methoden erstellen, die komplexe Forschungsfragen effektiv angehen.
Weltanschauungen und Forschung mit gemischten Methoden
In der Mixed-Methods-Forschung spielt die Weltanschauung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Durchführung von Studien. Eine Weltanschauung (oder ein Paradigma) bezieht sich auf die grundlegenden Überzeugungen und Annahmen, von denen sich die Forscher leiten lassen, wie sie die Realität verstehen, Wissen generieren und den Zweck ihrer Untersuchung bestimmen. Forscher, die mit gemischten Methoden arbeiten, müssen ihre Weltanschauung explizit darlegen, da sie ihre methodischen Entscheidungen, die Datenerhebung und die Analyse beeinflusst. Bei der Anwendung von Weltanschauungen auf Mixed-Methods-Studien nehmen Forscher in der Regel vier Positionen ein: (1) Verwendung einer einzigen Weltanschauung, (2) Annahme einer dialektischen Perspektive, die mehrere Weltanschauungen kombiniert, (3) Auswahl von Weltanschauungen auf der Grundlage des Studienkontexts und -designs und (4) Anpassung an die Weltanschauung ihrer wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Eine "beste" Weltanschauung für gemischte Methoden
Viele Mixed-Methods-Forscher argumentieren, dass der Pragmatismus die am besten geeignete Weltanschauung für die Mixed-Methods-Forschung ist. Tashakkori und Teddlie (2003a) bezeichneten den Pragmatismus als das vorherrschende Paradigma in der Mixed-Methods-Forschung, weil er die Integration von qualitativen und quantitativen Methoden in einer einzigen Studie ermöglicht. Der Pragmatismus konzentriert sich auf das, "was funktioniert", um das Forschungsproblem zu lösen, anstatt sich an strenge philosophische Grenzen zu halten. Zu den wichtigsten Grundsätzen des Pragmatismus gehören:
- Vorrang der Forschungsfrage vor starren methodologischen oder philosophischen Verpflichtungen.
- Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden, ohne philosophische Widersprüche auflösen zu müssen.
- Ablehnung der Dichotomie zwischen Postpositivismus und Konstruktivismus.
- Verzicht auf metaphysische Debatten über "Wahrheit" und "Realität" zugunsten praktischer, realitätsbezogener Problemlösungen.
Eine weitere bekannte Weltanschauung ist das transformative Paradigma, das von Mertens (2003) vorgestellt wurde. Dieses Paradigma konzentriert sich auf soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und die Befähigung von Randgruppen. Transformative Forscher zielen darauf ab, Systeme der Unterdrückung in Frage zu stellen und durch ihre Forschung eine demokratischere Gesellschaft zu schaffen. Diese Weltanschauung ist besonders relevant für Studien, die sich mit Fragen der Ethnie, des Geschlechts, der Behinderung und der wirtschaftlichen Ungleichheit befassen, denn sie betont, dass Wissen nicht neutral ist, sondern von der Machtdynamik in der Gesellschaft geprägt wird.
Dialektische Perspektive: Die Kombination mehrerer Weltanschauungen
Einige Forscher nehmen eine dialektische Perspektive ein, die die Integration mehrerer Weltanschauungen in einer einzigen Studie ermöglicht. Bei diesem Ansatz wird anerkannt, dass verschiedene Paradigmen widersprüchliche, aber wertvolle Erkenntnisse bieten, die im Dialog nebeneinander bestehen können. Wissenschaftler wie Greene (2007) und Greene & Caracelli (1997) argumentieren, dass es produktiver ist, die Spannungen und Widersprüche, die bei der Kombination von Paradigmen entstehen, zu akzeptieren, anstatt die Forscher zu zwingen, zwischen ihnen zu wählen. Diese Perspektive schätzt das dynamische Zusammenspiel von Ideen, das zu neuen Erkenntnissen führen kann, die aus einem einzelnen Paradigma nicht hervorgehen würden.
Aufbauend auf dieser Idee schlug Johnson (2013) das Konzept des dialektischen Pluralismus vor, das den Schwerpunkt darauf legt:
Respektvoller Umgang mit unterschiedlichen Weltanschauungen, Disziplinen und Interessengruppen.
Werteorientierte Forschung, die sowohl die Perspektive des Forschers als auch die der Teilnehmer widerspiegelt.
Zusammenarbeit auf der Grundlage von Fairness, Gerechtigkeit und Gleichheit zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses.
Weltanschauungen basierend auf Studienkontext und -design
Ein anderer Ansatz schlägt vor, dass Forscher ihre Weltanschauungen auf der Grundlage des spezifischen Kontexts ihrer Studie und der Art des von ihnen verwendeten Mixed-Methods-Designs auswählen sollten. Diese Haltung bietet Flexibilität und ermöglicht es den Forschern, je nach Bedarf zwischen verschiedenen Paradigmen zu wechseln. Zum Beispiel:
- Eine Studie könnte mit einer quantitativen Erhebung beginnen, die auf einer postpositivistischen Weltanschauung beruht und sich auf objektive Messungen und Hypothesentests konzentriert.
- Dieselbe Studie könnte mit qualitativen Fokusgruppen fortgesetzt werden, die in einer konstruktivistischen Weltanschauung verwurzelt sind und die subjektiven Erfahrungen der Teilnehmer erforschen, um die Umfrageergebnisse zu erklären.
- Bei der Integration beider Phasen könnten die Forscher eine dialektische oder pragmatische Haltung einnehmen, um die Ergebnisse kohärent zu interpretieren.
Dieser Ansatz steht im Einklang mit Maxwells (2011) Ansicht, dass Paradigmen Werkzeuge sind, die kreativ angepasst werden können, um sich an unterschiedliche Forschungssituationen anzupassen. Die Forscher werden ermutigt, ihre Weltanschauungen explizit darzulegen und zu erklären, wie diese Paradigmen ihre methodischen Entscheidungen beeinflussen.
Von der wissenschaftlichen Gemeinschaft geprägte Weltanschauungen
Schließlich richten einige Forscher ihre Weltanschauung an den gemeinsamen Überzeugungen und Praktiken ihrer wissenschaftlichen Gemeinschaft aus. In Anlehnung an Kuhns (1970) Konzept der Paradigmen betonte Morgan (2007), dass Paradigmen oft von Forschergemeinschaften geprägt werden, die gemeinsame Werte, Forschungsfragen und methodische Präferenzen haben. Zum Beispiel:
- In der Gesundheitsforschung können gemischte Methoden durch Evaluationsrahmen wie formative und summative Bewertungen beeinflusst werden.
- In der Bildungsforschung könnten gemischte Methoden eine Kombination aus quantitativen Bewertungen und qualitativen Fallstudien zur Untersuchung von Lernergebnissen darstellen.
Diese gemeinschaftsbasierte Perspektive erkennt an, dass Forscher oft Weltanschauungen annehmen, die auf ihren disziplinären Normen, beruflichen Netzwerken und den Erwartungen ihres akademischen Bereichs basieren.
Schlussfolgerung
In der Mixed-Methods-Forschung sind Weltanschauungen keine starren Vorschriften, sondern flexible Rahmen, die den Forschern bei ihren methodologischen Entscheidungen als Orientierung dienen. Unabhängig davon, ob sie einen pragmatischen, transformativen, dialektischen oder gemeinschaftsorientierten Ansatz verfolgen, müssen die Forscher ihre philosophischen Annahmen explizit darlegen und angeben, wie diese ihr Studiendesign beeinflussen. Indem sie die dynamische Beziehung zwischen Weltanschauungen, Kontext und Methodik erkennen, können Forscher mit gemischten Methoden robuste, anpassungsfähige und gesellschaftlich relevante Forschungsdesigns entwickeln.
Referenzen
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.
- Crotty, M. (1998). Die Grundlagen der Sozialforschung: Bedeutung und Perspektive im Forschungsprozess. London: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Das Sage-Handbuch der qualitativen Forschung (3. Aufl.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Greene, J. C., & Caracelli, V. J. (1997). Fortschritte bei der Bewertung mit gemischten Methoden: Die Herausforderungen und Vorteile der Integration verschiedener Paradigmen. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Mertens, D. M., & Tarsilla, M. (2015). Gemischte Methoden und Glaubwürdigkeit der Evidenz in der Evaluation. New Directions for Evaluation, 2015(138), 77-87.
- Rossman, G. B., & Wilson, B. L. (1985). Numbers and words: Combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study. Evaluation Review, 9(5), 627-643.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Gemischte Methodologie: Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.